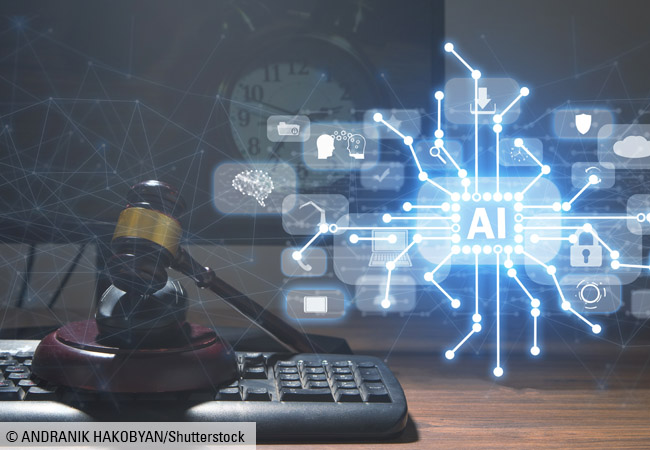Im Mai ist Astrid Wallrabenstein, Jura-Professorin an der Goethe-Universität, als Richterin in den 2. Senat des Bundesverfassungsgerichts gewählt worden. Nach Winfried Hassemer und Lerke Osterloh ist die 50-jährige Öffentlich-Rechtlerin die dritte Persönlichkeit aus dem Kreis der Frankfurter Rechtswissenschaften in diesem hohen Amt. Goethe-Uni online sprach mit Wallrabenstein über ihre ersten Wochen in Karlsruhe, ihre Aufgaben als Verfassungsrichterin und die Rolle des obersten Gerichts für die Politik.
Frau Professor Wallrabenstein, am 22. Juni wurden Sie vom Bundespräsidenten als Bundesverfassungsrichterin vereidigt. Haben Sie sich schon in Ihrem Amt eingelebt?
Die erste Einarbeitungsphase hat gut geklappt, worüber ich sehr froh bin. Das liegt vor allem an meinen Mitarbeitern. Es war ein guter Start.
Wie läuft das ab, wenn man als Richterin neu ans Bundesverfassungsgericht kommt? Bekommt man da erstmal einen Crash-Kurs im Bundesverfassungsrichterin-Sein?
Man wird einfach ins kalte Wasser geworfen und übernimmt sofort die laufenden Aufgaben.
Was waren die ersten Aufgaben?
Mein Feld ist sehr breit: Zwangsvollstreckung und -verwaltung, Wiederaufnahmen aus dem Strafrecht, Wiedergutmachungsfälle bezüglich der DDR oder auch Aufenthalts- und Staatsangehörigkeitsrecht. Die Verfahren sind in einem unterschiedlichen Stadium: Manche werden bald entschieden, manche sind neu, andere sind sehr eilig.
In der Öffentlichkeit bekommt man vor allem die spektakulären Fälle mit, über die im Fernsehen berichtet wird. Ist so etwas in nächster Zeit absehbar?
Wegen Corona waren solche Fälle in den vergangenen Monaten seltener, es gab keine mündlichen Verhandlungen. Das wird ab Oktober anders, da wird der Senat wieder mündlich verhandeln, erstmals unter den Corona-Hygiene-Maßnahmen. Das wird sicher eine Herausforderung.
Und worum wird es gehen?
Da geht es um ein Organstreitverfahren gegen die vorläufige Anmeldung des CETA-Abkommens, die schon ein paar Jahre zurückliegt. Das ist nicht ganz akut.
Sie sind ja schon unter Corona-Bedingungen vereidigt worden. Wie lief das ab?
Es gab einen kleinen Empfang, jeder hatte seinen eigenen Stehtisch. Bei der Vereidigung blieb der Bundespräsident am Pult stehen, ich bekam die Urkunde auch nicht überreicht, sondern durfte sie mir vom Tisch nehmen.
Sie sind von Bündnis 90 Die Grünen nominiert worden. Hat Sie das überrascht?
Sehr. Nach mir ist ja Frau Härtel von der SPD benannt und vom Bundesrat gewählt worden. Das habe ich natürlich mitverfolgt und war froh, dass meine Nominierung durch die Grünen leiser ablief. Sie hatten mich angefragt, aber es gab keine großartig in die Medien getragene Debatte. Ich hatte das Gefühl, dass das im Vorfeld gut geklärt war.
War es Ihr Ziel, eines Tages Richterin am Bundesverfassungsgericht zu werden?
Sowas kann man sich nicht vornehmen. Das kann sich nur durch viele glückliche Umstände ergeben. Ich war ja schon als Prozessvertreterin am BVerG. Vor diesem Gericht zu stehen, fand ich toll. Es war herausfordernd und beeindruckend.
Können Sie bereits einen Vergleich ziehen: Wie war es als Prozessbeteiligte am BVerfG, wie ist es jetzt als Richterin?
Natürlich wird sich meine Sicht auf dieses Gericht verändern, weil ich jetzt Teil dieses Gerichts bin. Aber das ist ein Prozess. Im Moment lerne ich vieles neu kennen, was sehr spannend ist.
Was geschieht mit Ihrem Status als Professorin der Goethe-Universität?
Ich bin und bleibe Professorin, das ist auch im BVerfG-Gesetz festgeschrieben. Ich bin nicht beurlaubt, sondern behalte meine Professur in einer abgespeckten Version. Obwohl ich keine Lehrverpflichtung habe, werde ich weiter Lehrveranstaltungen anbieten.
Inzwischen gibt es ja mehr Frauen als Männer beim BVerfG. Denken Sie, dass sich der weibliche Blick auf das Recht auch in den Urteilen niederschlägt?
Ich glaube nicht, dass etwas Neues passiert, weil in dem Senat jetzt mehr Frauen als Männer sitzen. Aber ich denke, dass sich im Vergleich zu der Zeit, in der es in der Rechtswissenschaft fast nur Männer gab und nur eine Frau im BVerfG saß, einiges geändert hat, besonders bei Gleichstellungsfragen. Aber das ist nicht nur deshalb so, weil Frauen anders denken, sondern auch, weil Männer heute anders denken.
Oft heißt es, das BVerfG greife zu sehr in die Politik ein. Sehen Sie sich jetzt als politisch mitgestaltende Person?
Das Gericht ist nicht zum politischen Gestalten da, und so versteht es sich auch nicht. Das BVerfG ist jedoch wichtig für die Politik. Seine Entscheidungen haben politische Auswirkungen, weil sich die Verfassungsorgane an die Urteile halten.
Sie haben mal einen Aufsatz geschrieben zum Demokratiekonzept des 2. Senats. Können Sie dazu etwas sagen?
Das war ursprünglich ein Vortrag im Rahmen des Forschungsprojekts „Die Wiedergewinnung des Humanen“. Die Frage war, ob die Verbindung zwischen Demokratie und Menschenwürde zu einer Wiedergewinnung des Humanen führt. Mein Beitrag kam aber zu einem etwas ernüchternden Ergebnis. Das BVerfG hat im Lissabon-Urteil zwar gesagt, dass das Demokratieprinzip auch in der Menschenwürde verankert ist, aber in der Rechtsprechung ist aus diesem Ansatz wenig geworden.
Das BVerfG hat aber doch die Aufgabe, das System an die Grundwerte dieser Gesellschaft rückzukoppeln.
Genau, aber aus dem konkreten Aufschlag, Demokratie in Verbindung mit der Menschenwürde zu sehen, hat das Gericht eben nicht so viel gemacht. Am Ende des Tages entscheidet das BVerfG immer nur über die Fragen, die aufgeworfen werden, und das hängt natürlich von den Fällen ab. Manche Fragen tauchen auf, andere nicht.
Bei Ihrem ersten Auftritt vor dem BVerfG ging es um Lebensversicherungen, und Sie haben für die Versicherten einen Vorteil erstritten. Wie haben Sie diesen Erfolg erlebt? War das etwas Besonderes?
Absolut! Es war schon deshalb besonders, weil es mein erstes Verfahren vor dem BVerfG war. Und es war sehr spannend, sich in die sehr spezielle Thematik einzuarbeiten und auszuloten, inwiefern das Versicherungsrecht auch etwas mit den Grundrechten zu tun hat. Ich habe den Bund der Versicherten vertreten, eine sehr kleine Verbraucherschutzorganisation. Das hatte schon etwas von David gegen Goliath: Auf der Gegenseite standen mir die großen Versicherungen gegenüber, und die hatten natürlich große Anwaltskanzleien beauftragt. Es kamen einige Vorstände, die Anwälte der Kanzleien und natürlich auch Vertreter der Bundesregierung: ein großer Auflauf meist älterer Herren. Und auf der anderen Seite waren nur kleine Verbraucherschutzbund und ich.
Ihr Erfolg wirkt sich ja auf den Geldbeutel von vielen Menschen aus.
Ja, allerdings gab es einen Wehrmutstropfen: Das BVerfG folgte weitgehend meiner grundrechtlichen Argumentation, aber die Gerichtsentscheidungen, die wir angegriffen hatten, wurden nicht aufgehoben. Das heißt: Was inhaltlich in dem Urteil stand, musste der Gesetzgeber erst einmal umsetzten. Dann kam die Finanzkrise… Zehn Jahre früher hätte es einen positiven Effekt auf den Geldbeutel der Versicherten gegeben, aber bis der Gesetzgeber das Urteil umgesetzt hatte, war da nicht mehr viel zu gewinnen.
Dennoch war es ein großer Erfolg.
Ja. So ein Urteil wirkt sich ja auch auf andere Verfahren aus. Konkret der BGH hat das in manchen Versicherungsfragen aufgegriffen. Ich denke, es ist deutlicher geworden, dass Versicherungen nicht alles mit dem Geld ihrer Kunden machen können.
Sie stammen aus Münster und haben in Freiburg studiert. Heute leben Sie in Darmstadt. Wie kam es dazu?
Das hat sich aus privaten Gründen so ergeben. Ich habe einen Darmstädter geheiratet.
Das ist strategisch eine ziemlich gute Wahl, ich meine, so zwischen Frankfurt und Karlsruhe.
Ich habe ihn natürlich nicht aus strategischen Gründen geheiratet (lacht). Wenn man feststellt, dass man sein Leben gemeinsam verbringen will, muss man sich irgendwann fragen, wo das sein soll.
Wie fanden Ihre Kinder es denn, dass Sie Verfassungsrichterin werden?
Zuerst fanden sie es alle ganz, ganz toll. Aber als wir realisiert haben, was es privat heißt, dass ich noch mehr weg sein würde als bisher, haben wir alle etwas geschluckt, auch mein Mann. Aber ich denke, wir bekommen das hin.
Sie müssen wahrscheinlich auch nicht jeden Tag im Gericht sein.
Nein, aber man muss jeden Tag wirklich viel arbeiten. Dafür kann ich auch Akten mit nach Hause nehmen. Aber momentan bin ich viel in Karlsruhe, weil ich auch einfach die Abläufe noch kennenlernen und eine Strategie dafür entwickeln muss, was man vor Ort machen muss und was auch von zu Hause gut klappt.
Sie gelten als sehr engagierte Hochschullehrerin, die auch die Studierenden für kniffelige Fragestellungen begeistern kann.
Momentan betreue ich noch einige Abschlussarbeiten, die mir einfach am Herzen liegen. Aber bei den Hausarbeiten muss ich mich zurückhalten, wegen der harten Fristen. Promotionen werde ich aber weiter betreuen. Im Wintersemester werde ich ein Kolloquium mit der Uni Gießen anbieten, da wird es um Migration und Teilhabe gehen.
Ist es Ihnen wichtig, im Lehrgeschehen involviert zu bleiben?
Ja, aber es muss mit meinen Aufgaben hier gut vereinbar sein. Ich muss die Sachen an der Uni so hinbekommen, dass ich dem Amt hier nicht schade.
Wird Ihre Professur in den nächsten zwölf Jahren immer nur vertreten?
Nein, die Professur soll neu ausgeschrieben werden. Ich hoffe, dass dadurch das Sozial- und Migrationsrecht auch künftig gut in Frankfurt verankert sein wird. Wenn ich von Karlsruhe aus einzelne Lehrveranstaltungen anbiete, dann geht das nicht in der Breite, die nötig ist, um den ganzen Bereich mit dem gesundheitsrechtlichen Institut und der Law Clinic, zu erhalten.
Warum haben Sie Jura studiert?
Ehrlich gesagt, hatte ich sehr wenig Vorstellungen von Jura, also konnte ich auch nicht besonders enttäuscht werden. Vielleicht war das eine naive Vorstellung, mit der ich ins Studium eingestiegen bin. Es hat aber funktioniert. Wie viele andere habe ich auch erst in der zweiten Runde, bei der Examensvorbereitung, verstanden, worum es wirklich geht.
Man ist auch so jung.
Ja, das Studieren besteht anfangs aus so vielen anderen Dingen als dem eigenen Fach: es geht darum, Leute kennenzulernen, fachfremde Veranstaltungen zu besuchen. Und wenn man das alles mitnimmt, macht man in den ersten Semestern weniger Jura. Wegen dieses Drum-herums tun mir alle leid, die jetzt mit dem Studium beginnen. Uniluft über den Computer schnuppern, das geht nicht.
Interview: Anke Sauter; Foto: Uwe Dettmar