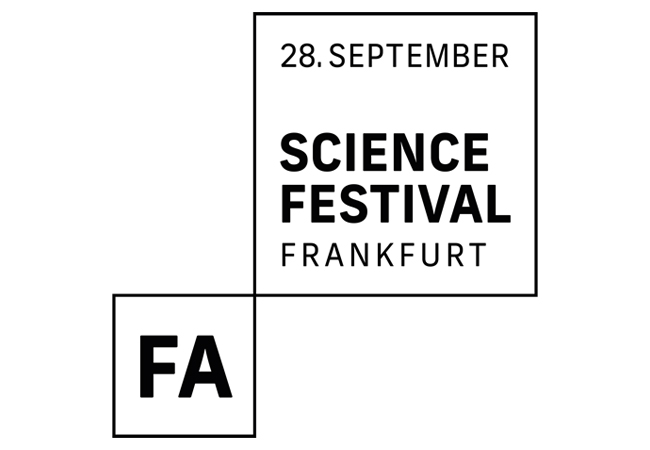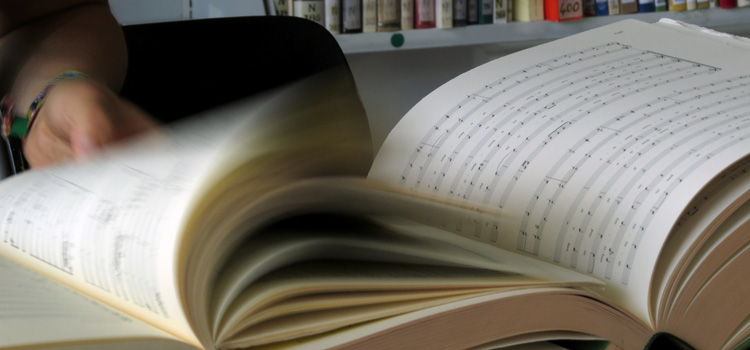
mit Musik.
Frankfurt mit seinem großen Kulturangebot bietet ein gutes Umfeld für den Bachelorstudiengang Musikwissenschaften. Hier geht es um Musiktheorie, um den reflektierenden Umgang mit Komponisten vom Mittelalter bis heute.
Studierende mit Geigenkasten oder Bratschenkoffer sieht man selten durch die Flure der Goethe-Uni laufen. Wer hier Musikwissenschaft studiert, sollte zwar gern Musik hören und Noten lesen können, muss aber kein Instrument spielen. Musikwissenschaft hat nichts mit Instrumentalausbildung zu tun und bereitet auch nicht auf das Lehramt für das Fach Musik vor.
Vielmehr geht es um alle Arten des theoretischen und reflektierenden Umgangs mit Musik. Und zwar Musik von A bis Z: Das Spektrum reicht von Beethoven bis Björk, von Madrigal- bis Filmmusik, von Grand Opéra bis Videooper. „Musik hat viel mit Emotionen zu tun. Der persönliche Musikgeschmack ist im Studium aber weniger relevant.
Es geht eher darum, wissenschaftliche Ansätze des Musikverstehens kennenzulernen und weiterzuentwickeln“, erklärt Sarah Mauksch, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin am Institut arbeitet. Wer schon ein Instrument spielt oder singt, bevor er sich einschreibt, hat Vorteile. Wem diese Vorkenntnisse fehlen, dem bietet die Fachschaft eine Einführung in das Notenlesen an.
300 Studierende
Erst 2013/14 wurde der Magisterstudiengang auf Bachelor umgestellt. Seitdem hat sich mit der Neubesetzung von Professuren und ihren jeweiligen Forschungsschwerpunkten personell und auch inhaltlich viel getan am Institut. Rund 300 Studierende belegen das Fach. Im Wintersemester kommen meist 80 Erstsemester dazu, im Sommersemester etwa 50. Masterstudenten gibt es noch vergleichsweise wenige, weil das Angebot erst zwei Jahre alt ist.
Zu den Highlights in Frankfurt gehört für Sarah Mauksch die enge Kooperation mit der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (HfMDK). „Wir versuchen bei mindestens zwei Lehrveranstaltungen pro Semester kooperative Elemente einzubauen, um mehr Musikpraxis in die Seminare zu integrieren und den Kontakt zu Instrumentalisten, Komponisten und Künstlern herzustellen“, sagt sie.
Auch um neuartige Lehrkonzepte geht es. Wenn die Musiker aus der Eschersheimer Landstraße mit den angehenden Musikwissenschaftlern auf dem Campus Bockenheim zusammentreffen, wo das Institut für Musikwissenschaften derzeit noch angesiedelt ist, „dann ist das für beide Seiten unglaublich fruchtbar“, ist Mauksch überzeugt.
Musik analysieren, historisch und ethnologisch einordnen, das gehe viel besser, wenn man die Warte derer kennt, die Musik machen. „Wie habt Ihr Euch das Stück im Quartett erarbeitet? Warum spielt ihr eine bestimmte Stelle so und nicht anders?“, solche Fragen konnten die Studierenden der Goethe-Uni in einem Seminar über das Kaiserquartett von Haydn direkt denen stellen, die dabei waren, es einzustudieren.
„So bekommen sie eine gute Vorstellung davon, wie man sich Stücke erarbeitet und wie die Arbeitsabläufe in einem Ensemble aussehen“, erklärt Mauksch, die die Zusammenarbeit mit den Lehrenden der HfMDK koordiniert. Schließlich bereitet das Studium darauf vor, Musik beschreibbar zu machen und zu kontextualisieren: als Dramaturg im Opernhaus, als Redakteur bei Rundfunk, Fernsehen oder Printmedien, als Konzertkritiker, in der Organisation von Musikfestivals oder in den Presseabteilungen der Konzerthäuser, in Archiven, Bibliotheken, im Stiftungswesen oder nicht zuletzt in der Forschung.
„Dort finden unsere Absolventen gute Stellen“, weiß Mauksch. Überdies besorgen Musikwissenschaftler in Verlagen und freien Forschungsinstituten die Edition der vorliegenden Quellen, auf deren Basis ein verlässlicher Notentext entstehen kann. Darauf führen im Grundstudium propädeutische Kurse hin wie Harmonielehre, Satzanalyse oder musikalische Analyse.
[dt_call_to_action content_size=”small” background=”fancy” line=”false”]
Vier Fragen an Verena Kolb, Sprecherin der Fachschaft Musikwissenschaft und Bachelorstudentin im 6. Semester
1. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, was hat Sie motiviert, Musikwissenschaft zu studieren?
Ich mache, seit ich klein bin, Musik und habe ein musisches Gymnasium besucht. Dass ich beruflich etwas mit Musik machen will, stand daher schon sehr früh fest. Zunächst habe ich nach dem Abi ein Instrumentalstudium im Jazzbereich angestrebt. Diese Idee habe ich aber nach Einblicken in den Studiengang verworfen, weil ich gemerkt habe, dass das einfach nichts für mich ist und es mir wahrscheinlich auch die Freude am Instrument durch den hohen Konkurrenzdruck verdorben hätte. Damit fiel die Wahl dann auf Musikwissenschaft.
2. Erfüllt das Studium Ihre Erwartungen?
Ja, das Veranstaltungsangebot ist relativ breit gefächert, es gibt eigentlich zu jedem Bereich in der Musik Veranstaltungen – von alter Musik bis zur Unterhaltungs- oder Filmmusik ist immer was dabei. Auch die Qualität der Veranstaltungen ist immer hoch, man merkt, dass die Dozenten Spaß am Job und großes Interesse am Thema haben. Die Dozenten sind außerdem wirklich kooperativ und gehen auf die Studenten ein. Auch wenn es mal ein Problem gibt, lässt sich immer eine Lösung finden. Das Einzige, was ich mir wünschen würde, wären evtl. mehr Veranstaltungen aus dem Bereich Harmonielehre oder vielleicht mal ein Gehörbildungsseminar, aber das sind einfach meine persönlichen Interessen.
3. Können Sie die Goethe-Uni/den Standort Frankfurt für das Fach weiterempfehlen?
Ja, das Studienklima hier ist wirklich gut. Man muss keine Angst davor haben, Fragen zu stellen, und die Seminare sind nicht so überfüllt, da der Studiengang generell nicht sehr groß ist. Dadurch kann auf jeden Einzelnen recht gut eingegangen werden. Auch in der Fachschaft haben wir immer wieder tolle Projekte, Feste oder autonome Tutorien; wer selbst etwas machen möchte, ist immer willkommen und wird unterstützt. Ebenso gibt es auch viele Gastvorträge zu allen möglichen Bereichen aus der Musik und wer gerne selber Musik macht, der kann sich im Collegium Musicum im Chor, dem sinfonischen Blasorchester oder dem Orchester austoben. Das geht übrigens auch, wenn man nicht Musikwissenschaft studiert.
4. Wissen Sie schon, wo es beruflich hingehen soll?
Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Nach dem Bachelor werde ich auf jeden Fall erst mal den Master dranhängen. Bis jetzt tendiere ich tatsächlich dazu, freischaffend zu arbeiten oder sogar zu promovieren und dann zu unterrichten. Aber wer weiß, was die Zeit noch so bringt …
[/dt_call_to_action]
Danach kann der Schwerpunkt beispielsweise auf Historische Musikwissenschaft gelegt werden, mit Themen wie Musik des 20. Jahrhunderts oder Operngeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts. Eine Frankfurter Besonderheit ist die Professur für Musikethnologie, die sich allerdings gerade im Besetzungsverfahren befindet.
Sie sorgt für die Ausweitung des fachlichen Horizonts und berücksichtigt neben der Erforschung der Musik außereuropäischer Kulturen auch musiksoziologische Themen. Weiterer Schwerpunkt sind zeitgenössische Musik und Editionspraxis. Gerade zu letzterem Themenfeld tragen die an das Institut gebundenen Forschungsprojekte (OPERA – Spektrum des europäischen Musiktheaters in Einzeleditionen, Arbeitsstelle Frankfurt der Gluck-Gesamtausgabe, Arbeitsstelle Frankfurt der Bernd Alois Zimmermann- Gesamtausgabe, Freischütz Digital) wichtige Praxisbezüge bei.
Maurice B., 20, heute im vierten Semester Musikwissenschaft Bachelor, mit Nebenfach Philosophie, wollte das Fach ursprünglich nur belegen, um sich an Hochschulen mit dem Studienfach Komposition zu bewerben. „Denn unter dem Fach Musikwissenschaft konnte ich mir nichts vorstellen.“ Inzwischen hat er diesen Plan verworfen. „Ich möchte nun nach meinem Studium weiter in die Dramaturgie.“
Die Goethe-Uni kann er weiterempfehlen, weil „die Lage in Bockenheim gut zu erreichen ist und der Campus übersichtlich ist“. Mauksch weiß, dass der Campus Bockenheim vor allem für diejenigen nicht ideal ist, die für meist geisteswissenschaftliche Nebenfächer wie TFM, Philosophie, Soziologie oder Germanistik auf den Campus Westend müssen. Dorthin führt der Weg auch bei inneruniversitären Kooperationen:
So gibt es mit der Romanistik gemeinsame Lehrveranstaltungen etwa zum französischen Musiktheater oder zur italienischen Oper. „Auch für den Master Dramaturgie des Instituts für Theater-, Film und Medienwissenschaften und für den interdisziplinären Master Ästhetik öffnen wir unsere Veranstaltungen“, sagt Mauksch.
Für Phia J, 24 Jahre alt, 4. Semester im Masterstudiengang, stand schon zu Schulzeiten fest, „dass ich ein Studium im Bereich Musik aufnehmen möchte, jedoch kein Lehramt und kein rein künstlerisches Fach wählen wollte.“ Bei ihrer Recherche stieß sie auf das Fach Musikwissenschaft. Für den Master wechselte sie an die Goethe-Universität.
Lob findet sie sowohl für die breite Palette an Lehrveranstaltungen als auch die Vernetzung mit der Stadt. „Dies sehe ich auch als einen großen Vorteil des Standortes Frankfurt, der zahlreiche Möglichkeiten bietet, sowohl in der Stadt selbst als auch im gesamten Rhein- Main-Gebiet, bereits während des Studiums berufspraktische Erfahrungen zu sammeln.
Darüber hinaus ist die Dichte an kulturellen Veranstaltungen überaus hoch.“ Ihre Zukunft sieht sie im Orchestermanagement und der Konzert- und/oder Musiktheaterdramaturgie. „In beiden Bereichen habe ich durch Praktika und Hospitanzen bereits einige Erfahrungen sammeln können.“
Kooperation mit der HfMDK
Bereits im Bachelorstudiengang unterstützt das Praxismodul mit Praktikum und berufspraktisch orientiertem Seminar zum Studium die Berufsorientierung, weil es Einblicke in die vielfältigen Arbeitsfelder der Musikwissenschaft ermöglicht. „Zum Beispiel bieten wir in diesem Semester in Kooperation mit der HfMDK ein Praxisseminar an, in dem es darum geht, eine Jubiläumsausstellung für den Frankfurter Cäcilienchor vorzubereiten“, sagt Sarah Mauksch.
Aktuell ist am Institut ein Programm für Studieneinsteiger in der Entwicklung. Damit Musikbegeisterte an der Goethe-Uni noch schneller in den Takt kommen. Sie haben viele Möglichkeiten im Rhein-Main-Gebiet, was Praktika und damit potentielle spätere Arbeitgeber angeht. Sie reichen von Institutionen wie Oper, Alter Oper, der Telemanngesellschaft, dem Ensemble Moderne und der Internationalen Ensemble Akademie Frankfurt (IENA) bis zu Festivalveranstaltern.
Dass es immer Liebhaber von Beethovenkonzerten geben wird, davon ist Musikwissenschaftlerin Mauksch überzeugt, „aber das Studium bei uns öffnet den Blick auch für zeitgenössische Komponisten – von Wolfgang Rihm bis Simon Steen-Andersen, von Pauline Oliveros bis Annesly Black.“
Sie beziehen immer häufiger auch neue Medien in ihre Musik und musikalischen Darbietungsformen mit ein und verändern damit das Zuhören, gehen über klassische Orchestermusik hinaus. „Wir können hier im Rhein-Main-Gebiet wirklich aus dem Vollen schöpfen. Das Angebot ist riesig und damit auch die Möglichkeit für Studierende, Musik und Konzerte live zu erleben.“
Texte: Julia Wittenhagen
Dieser Artikel ist in der Ausgabe 3.18 des UniReport erschienen. PDF-Download »