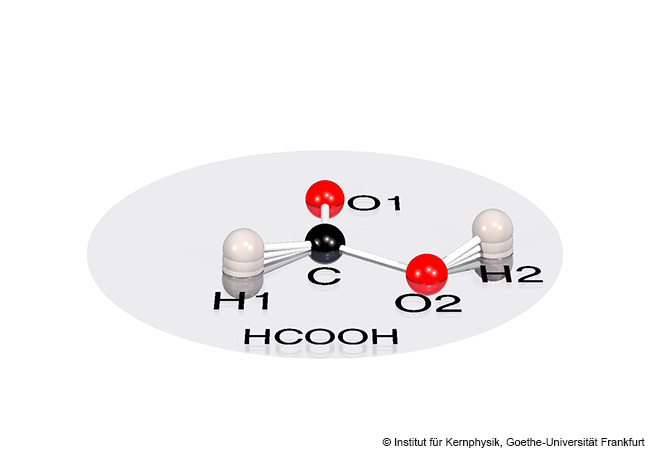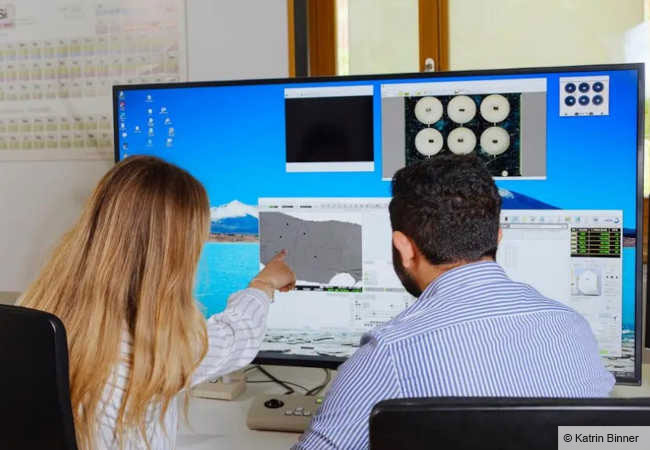Zwei neue Fellows am Forschungskolleg Humanwissenschaften

Die italienische politische Theoretikerin Dr. Clementina Gentile Fusillo arbeitet auf Einladung von Professor Rainer Forst und dem Justitia Center for Advanced Studies zum Thema „Macht und der Repräsentant: Auf dem Weg zu einer normativen Theorie demokratischer Repräsentation“ am Forschungskolleg. „Diese Forschung knüpft an ein Modell der demokratischen Repräsentation an, das ich in der Vergangenheit entwickelt habe. Es beschreibt demokratisches Repräsentieren als eine ständige Bewegung des Repräsentanten zwischen zwei Beziehungen, die gleich wichtig sind: der Beziehung zwischen ihm und seiner Wählerschaft und der Beziehung zwischen ihm und den Repräsentanten anderer Wählerschaften. Ich wollte mein zweigliedriges Modell aktualisieren, weil ich erkannte, dass das Phänomen komplexer ist. So ging es mir zunächst darum, die Dynamiken der Macht – das heißt die Art und Weise, wie Repräsentanten Macht ausüben und ihr unterworfen sind – nicht mehr in zwei, sondern in vier Beziehungen zu untersuchen, die ich als konstitutiv für die Praxis der Repräsentation ansah und die lesbar werden, wenn wir sie aus der Sicht des Repräsentanten betrachten. Es handelt sich um die Beziehungen zwischen dem Repräsentanten und seiner Wählerschaft, zwischen ihm und der Öffentlichkeit, zwischen ihm und den Repräsentanten anderer Wählerschaften und die Beziehung des Repräsentanten zu sich selbst.“
Aber die Sache ist eigentlich noch viel komplexer, betont Gentile Fusillo. Sie ist daher zu der Auffassung gelangt, dass eine kleine, aber entscheidende Reformulierung ihres aktualisierten Modells notwendig ist: „Streng begrifflich gesehen ist das Repräsentieren anderer in der Tat im Wesentlichen eine rekursive Bewegung zwischen der Beziehung des Repräsentanten zu den Repräsentierten und seiner Beziehung zu anderen Repräsentanten, und praktisch erfährt der Repräsentant auf dem Weg hin und her zwischen diesen beiden gleichermaßen wesentlichen Beziehungen tatsächlich immer auch die Einsamkeit der Beziehung zu sich selbst. In heutigen Demokratien kann dieses Hin und Her aber nur über die kritische Infrastruktur der Demokratie, wie J.-W. Müller es nennt, erfolgen – also gleichsam auf den Schienen der Parteien und den Autobahnen der Medien.“ Die Praxis des Repräsentierens, so Gentile Fusillo, erfordert also, dass der Repräsentant mit seinen Wählern, mit anderen Repräsentanten, mit sich selbst, aber auch, und das ist ebenso wichtig, mit seiner Partei und mit den Medien in Beziehung tritt. Jede dieser Beziehungen ist ein Ort der Macht, „ein Raum der Rechtfertigung, der beeinflusst, besetzt oder kompartmentalisiert werden kann, um es mit Rainer Forsts Worten zu sagen. Die Hypothese, die ich derzeit untersuche, lautet, dass die Veränderungen in der Form, die repräsentative Demokratien annehmen (von B. Manins parlamentarischer, parteipolitischer und Publikumsdemokratie bis hin zu populistischen und epistemischen ‚Entstellungen‘, um es mit N. Urbinati zu sagen), als unterschiedliche Konfigurationen der vielfältigen Rechtfertigungsräume verstanden werden können, die das politische Repräsentieren anderer von einem erfordert. Ich glaube, dass dies eine noch nicht ausreichend erforschte Perspektive auf unsere kränkelnden Demokratien ist.“
Wie sieht die Forscherin den Aufstieg rechtspopulistischer Parteien in vielen westlichen Ländern und die Präsenz autoritärer Führer? Stellt dies eine besondere Herausforderung für die Formulierung einer Theorie der demokratischen Repräsentation dar? „Ja“, betont sie: „Es verlangt, dass wir – wenigstens! – versuchen zu verstehen, uns darüber zu verständigen und zu erklären, inwiefern die Repräsentanten dieser Parteien die Dinge schlecht gemacht haben, wem sie dadurch Unrecht getan haben und ob die Neugestaltung repräsentativer Institutionen und Praktiken uns helfen kann, das Fehlverhalten schlechter Repräsentanten einzudämmen und das Handeln guter Repräsentanten zu ermöglichen. Mit anderen Worten, es braucht etwas, das nur schwer zu liefern ist: eine normative Theorie der demokratischen Repräsentation für diese Krisenzeiten.“
Gentile Fusillo betont, dass der Kontakt mit dem Justitia Center for Advanced Studies und dem Netzwerk Normative Ordnungen entscheidend für die jüngste Entwicklung ihrer Ideen war: „Es gibt kaum eine Diskussion, die mich nicht dazu gezwungen hat, mein Verständnis von den Herausforderungen politischer Selbstbestimmung zu überdenken.“ Insgesamt bewertet sie ihren Aufenthalt am Forschungskolleg als wertvolle Erfahrung. „Ich fühle mich geehrt, in einer blühenden intellektuellen Gemeinschaft von Mitarbeitern und Forschern willkommen geheißen zu werden; ich bin auch sehr dankbar für die Herzlichkeit und aufrichtige Freundlichkeit, die ich hier am Kolleg gefunden habe.“
Auch die Philosophin Dr. Larissa Wallner ist einer Einladung von Rainer Forst und dem Justitia Center for Advanced Studies gefolgt. Wallner beschäftigt sich mit der Zukunft der Demokratie, stellt die Frage, wie Demokrat*innen, die für eine offene und gerechte Gesellschaft eintreten, trotz der düsteren Entwicklungen eine Haltung finden, die effektives politisches Handeln ermöglicht. „Die Ohnmacht, mit der viele Demokrat*innen dem gegenwärtigen Momentum reaktionärer Kräfte zusehen, spielt genau diesen Kräften in die Hände. Eine philosophische Ressource liegt in Kants Verständnis der zweifachen Natur des Menschen: Wird Geschichte als Verkettung von Ursachen und Wirkungen begriffen, präsentiert sich die Krise der Demokratie als Entwicklung, die wir bloß beobachten können. Werden Demokratie und ihr Souverän – das Staatsvolk im Sinne der Bevölkerung ungeachtet der Staatsbürgerschaft – aber als vernunftbegabte Akteure begriffen, wird deutlich, dass nicht nur die Gegner*innen der Demokratie, die mitunter fälschlicherweise in ihrem Namen sprechen, über Gestaltungskraft verfügen. Deshalb analysiere ich, welche adaptiven Fähigkeiten und Haltungen der demokratische Souverän je entwickeln muss, um der Erosion der Demokratie entgegenzuwirken. Die erforderliche, kritische Anpassungsfähigkeit betrifft also zunächst das politische Selbstverständnis der Zivilgesellschaft und umfasst kollektive Formen des Widerstands. Nicht unverbunden damit scheint der öffentliche Meinungsbildungsprozess, der sich in der Wahlentscheidung niederschlägt, der eigentliche Krisenherd der Demokratie zu sein: Ein signifikanter Prozentsatz des Wahlvolks wählt nicht bloß nicht im universalistischen Sinne vernünftig, also politisch gerecht und normativ richtig, sondern nicht einmal im eigenen Interesse. Zum Verständnis dieser internalisierten Fremdbestimmung als ‚logischer Eigensinn‘ und ‚falsches Bewusstsein‘ ziehe ich Überlegungen Hannah Arendts zu Wahrheit und Politik und Sheldon Wolins Analyse des ‚invertierten Totalitarismus‘ heran, in der Wolin die schleichende Übernahme des Politischen durch die Logik und die Interessen der Ökonomie beschreibt. Zentral sind für mich zudem Kants Begriff des öffentlichen Gebrauchs der Vernunft und seine berühmten drei Regeln eines universalistischen, gleichwohl pluralistischen Gemeinsinnes: 1. Selbstdenken, 2. an der Stelle eines jeden anderen denken und 3. jederzeit mit sich selbst einstimmig denken.“
Larissa Wallner beschäftigt sich besonders mit der Zunahme globaler Informationsflüsse, ihrer Komplexität und der Beschleunigung ihrer Verbreitung in der digitalen Öffentlichkeit sowie der Gefahr gezielter Desinformation. Was sich bei X und META gerade abzeichnet, sieht sie sehr kritisch: „Diese Entwicklungen, aber auch die normalisierte, unverhohlene Einflussnahme auf politische Entscheidungsträger durch US-Tech-Milliardäre lassen sich teils im Lichte der genannten Übernahme des Politischen durch die Logik der Ökonomie begreifen. Zugleich werden sie von einem durchaus politischen, anti-ökologischen, anti-feministischen und anti-pluralistischen Backlash getragen. Dagegen ist es verfehlt, Faktenchecks und Maßnahmen gegen Hassrede als verzichtbar oder gar als Zensur der öffentlichen Rede zu begreifen. Denn es handelt sich bei den Sozialen Medien nicht um einen Raum des herrschaftsfreien Diskurses. Stattdessen sind die Sozialen Medien von ökonomischen Interessen durch Algorithmen gesteuerte Foren, die nach der Logik von Aufmerksamkeit und Zeit auf das Abgreifen der Daten der User*innen abzielen. Dort setzt sich nicht durch, was wohlbegründet ist, beispielsweise, weil es auf wissenschaftlicher Expertise oder einem fairen deliberativen Prozess beruht. Stattdessen dominiert, was prägnant und oft verkürzt sowie emotionalisierend von privilegierten Personen mit extremer Reichweite artikuliert wird. Die Gefahr gezielter Desinformation liegt dabei nicht so sehr darin, dass sie nicht als solche nachweisbar ist, sondern darin, dass sich Desinformationen viel schneller und weiter verbreiten als ihre Richtigstellung. Die gezielte Manipulation von Algorithmen, um bestimmten Akteuren noch mehr Diskursmacht zu verschaffen, verstärkt die Verzerrung, die von den sozialen Medien ausgehend in die politische Öffentlichkeit hineinreicht, nur noch zusätzlich.“ Besonders beunruhigend sei, dass die dringlichen, wichtigen ökologischen Fragen der Gegenwart, die eigentlich selbst ökonomisch und politisch seien, durch das Erstarken anti-demokratischer sowie wissenschaftsfeindlicher Kräfte und andauernde internationale Konflikte in den Hintergrund gedrängt würden.
Wallner betont: „Ich bin ausgesprochen dankbar für die inspirierenden, kritischen internationalen Kolleg*innen, wie Regina Schidel, Mahmoud Bassiouni, Aliénor Ballangé und Chiara Destri und viele andere im Kolloquium für politische Theorie, in dem Rainer Forst eine außergewöhnlich engagierte und internationale Diskussionskultur schafft. Auch der Austausch in Bad Homburg mit Belén Pueyo-Ibáñez, Philip Mills, Clementina Gentile Fusillo und Gladys Kalichini ist für mich sehr bereichernd. Das Forschungskolleg für Humanwissenschaften selbst bietet einen exzellenten Rahmen für konzentriertes Arbeiten.“
Justitia Center for Advanced Studies
Das Justitia Center for Advanced Studies ist ein Forum für politische Theoretiker*innen und Philosoph*innen, die sich für die drängenden politischen Fragen unserer Zeit interessieren. Das von der Alfons und Gertrud Kassel-Stiftung finanzierte Zentrum wird von Prof. Dr. Rainer Forst an der Goethe-Universität geleitet. Es lädt jedes Jahr bis zu drei Postdoktorand*innen dazu ein, sich dem wissenschaftlichen Umfeld in Frankfurt und vor allem auch dem Netzwerk des Forschungszentrums Normative Ordnungen anzuschließen, um hier ihre Forschungsprojekte durchzuführen. Gleichzeitig sind die Stipendiat*innen Fellows am Forschungskolleg Humanwissenschaften in Bad Homburg.