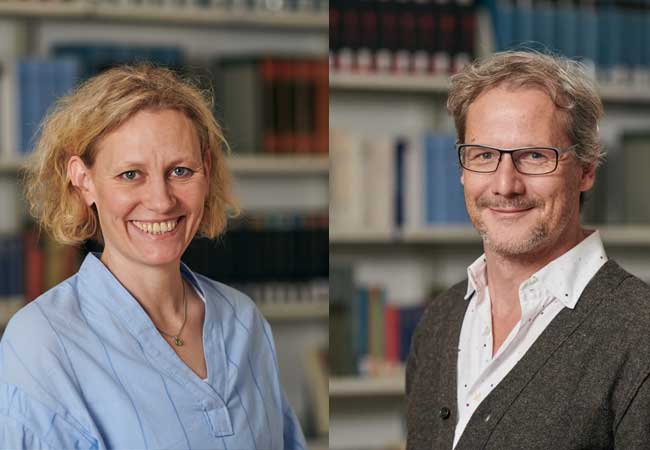»Der Müll, die Stadt und der Tod« – Erinnerung an einen Theaterskandal

Werner Fassbinder »Der Müll, die Stadt und der Tod« (November 1985).
Foto: ullstein bild – amw
Im Oktober 1985 besetzten Mitglieder der Jüdischen Gemeinde Frankfurt die Bühne der Kammerspiele, um die Premiere der Uraufführung von Rainer Werner Fassbinders Stück »Der Müll, die Stadt und der Tod« zu verhindern. Auf dem Symposium »[Bühnen] Besetzungen«, das vom 23. bis 25. April 2021 stattfand, nahmen Zeitzeug*innen, Wissenschaftler*innen und Künstler*innen eine Neubewertung dieses historischen Aktes zivilen Ungehorsams aus heutiger Perspektive vor. Die Veranstaltung war eine Kooperation von Schauspiel Frankfurt, Jüdisches Museum Frankfurt, Fritz Bauer Institut und der Theaterwissenschaft der Goethe-Universität Frankfurt am Main, ein Mitschnitt der Veranstaltung ist auf YouTube abrufbar.
UniReport: Herr Professor Müller-Schöll, die Veranstaltung [Bühnen]Besetzungen war dem wohl größten Theaterskandal in der Geschichte der BRD gewidmet. Welche Sichtweisen auf das Stück und seine Inszenierung wurden formuliert und diskutiert, was war für Sie persönlich aufschlussreich?
Nikolaus Müller-Schöll: Fassbinders Stück „Der Müll, die Stadt und der Tod“ polarisiert weiterhin. Einige der jüdischen Mitbürger*innen, die damals die Bühne der Kammerspiele des Frankfurter Schauspielhauses besetzten, sehen es noch heute als „antisemitisch“ und „Dreck“ an. Kolleg*innen, die es genau analysiert und im Kontext gelesen haben, untermauern die Sicht, dass Fassbinders Bekundung ernst zu nehmen ist, dass es eine Reaktion auf den wieder aufflammenden Antisemitismus im Frankfurt der frühen 70er- Jahre sei. Was ich in den Vorbereitungen im Dialog mit Fritz Bauer Institut, Jüdischem Museum, Schauspiel Frankfurt und Fassbinder Center gelernt habe, ist, dass diese damalige „Bühnenbesetzung“ für die jüdische Gemeinschaft in der Stadt und im ganzen Land ein wichtiger Akt der Emanzipierung und des Empowerments war: Es galt, der Gesellschaft deutlich zu machen, dass die verschwindend kleine Gruppe der jüdischen Mitbürger*innen, darunter viele Überlebende der Konzentrationslager, ihr Recht einfordert, bei Fragen ihrer Repräsentation überall und jederzeit mitzureden. Aus heutiger Sicht könnte man sagen, dass sie die Wahrnehmung der „Opfer-Perspektive“ einforderten.
Schaute die Theaterwissenschaft damals anders auf die Inszenierung/auf das Stück als heute?
Ja, das kann man so sagen: Mein Vorgänger verteidigte die Auffassung des Theaters, dass das Stück wie die Inszenierung nicht antisemitisch sei und deshalb aufgeführt werden sollte. Wir sehen heute in der Theaterwissenschaft die verhinderte Aufführung als Gesamtkomplex. Sie war der Zusammenprall mindestens dreier gleichermaßen berechtigter Interessen und Perspektiven: Auf der einen Seite stand, dass Überlebende der Shoah einforderten, dass ein Stück, das von ihnen als unerträglich angesehen wurde, nicht auf die Bühne kommen darf. Auf der anderen Seite stand der auch berechtigte Hinweis auf die Freiheit der Kunst, die zum ersten gehörte, was die Nationalsozialisten beseitigten. Und dann ist da die Sicht Fassbinders auf das, was man mit Alexander Mitscherlich als „Unwirtlichkeit der Städte“ bezeichnen könnte, die Zerstörung des Gemeinwesens, die bis in die intimsten Verhältnisse hineingeht. Alles das ging in die Auseinandersetzung ein. Und wir sehen heute unter dem Vorzeichen eines erweiterten Theaterbegriffes in dieser Auseinandersetzung selbst das, was an diesem ganzen Skandal wichtig war: Hier wurde Theater dem Anspruch gerecht, Ort einer wichtigen gesellschaftlichen Debatte zu sein, die nur hier geführt werden kann. Das war für alle sehr schmerzlich. Aber es war auch ein wichtiger Moment der Selbstverständigung und der Aushandlung.
Wie steht es um den Vorwurf des Antisemitismus, lässt sich dieser überhaupt (auch) theaterwissenschaftlich bewerten?
Der Antisemitismus ist selbst ein äußerst komplexes Phänomen. Das Problem beginnt dabei, dass wir nicht annehmen dürfen, dass es sich bei denjenigen, gegen die er sich richtet, um diejenigen handelt, die jüdischen Glaubens sind, sich als Juden definieren oder aus jüdischen Familien kommen, auch wenn diese natürlich bis heute extrem gefährdet sind durch antisemitische Übergriffe. Die antisemitische Propaganda der Nazis schuf ein Feindbild des Juden, dem alles zugeschrieben wurde, was man fürchtete oder hasste, nicht zuletzt an sich selbst. Viele der damals teils übernommenen, teils geschaffenen Narrative überleben bis heute, andere sind hinzugekommen. Ich glaube, dass Fassbinder ein Stück schreiben wollte, in dem er sich als jemand, der als Homosexueller selbst einer von den Nazis verfolgten und ermordeten Minderheit angehörte, die bis in seine Gegenwart hinein und darüber hinaus Diskriminierungen ausgesetzt war, solidarisch mit Angehörigen anderer Minderheiten zeigen wollte: Mit den Sexarbeiterinnen, den Sinti und Roma, den Menschen mit Behinderungen, das Stück ist voll von Randfiguren, die jede für sich bis heute unser aller Solidarität bedürfen. Aber seine Art der Solidarität bestand darin, dass er die kursierenden Gemeinplätze und Stereotypen zitierte und durchkreuzte in der Art, wie er sie auf die Bühne brachte. Wie seine Filme sind auch seine Stücke keine realistischen Abbilder von irgendetwas. Und das veröffentlichte Stück sah er selbst als unfertiges Skript an. Als das Stück dann andererseits auf die Bühne kommen sollte, triggerte es, zumal begleitet von kolportierten Intentionen wie der, dass nun ein „Ende der Schonzeit“ gekommen sei, alte und neue Formen des Antisemitismus in der Stadt. Wenn man aus der Distanz liest, wie unsensibel etwa der damalige Intendant mit den protestierenden Überlebenden der Shoah diskutierte, wenn man sieht, wie wenig das probende Ensemble auf die Proteste vorbereitet war, und wenn man liest, welche Folgen die Entscheidung, das Stück auf den Spielplan zu setzen, für die jüdischen Überlebenden der Shoah hatte –, Morddrohungen, Retraumatisierungen – dann scheint mir, dass man dem Theater vorwerfen muss, dass es nicht genügend bedacht hatte, welche Art von Katalysator das für bestehenden und neu entstehenden Antisemitismus in der Gesellschaft werden würde. Das heißt: Ich würde immer verfechten, dass jede erdenkliche Gemeinheit ihren Platz haben können sollte auf einer Bühne. Denn dort kann sie verhandelt, diskutiert, aus der Verdrängung geholt werden. Und das ist eine wichtige Aufgabe von Theater. Aber ich würde mit Blick auf die Fassbinder-Affäre auch dafür plädieren, dass eine Mehrheitsgesellschaft in jedem Fall, wo sie sich mit Problemen von Minderheiten beschäftigt, nicht für diese und statt dieser reden sollte, sondern mit diesen und in ihrer Nähe. Das wäre auch mein Rat für jene Fragen, die unter den Stichworten „Identitätspolitik“ und „Cancel Culture“ heute polemisch verhandelt werden.
Studierende der Goethe-Universität haben ein Szenisches Projekt zu »Bühnenbesetzungen. Die Affäre(n) um Rainer Werner Fassbinders Stück Der Müll, die Stadt und der Tod« vorgestellt – worum ging es dabei?
Unsere Studierenden haben die Bühnenbesetzung als Ausgangspunkt für eine ganze Reihe weiterer Auseinandersetzungen in Frankfurt begriffen, bei denen über den Umgang mit der Vergangenheit und die Erinnerung gestritten wurde. Sie haben einen Audio-Walk erarbeitet, der vom Schauspiel als dem Ort der „Bühnenbesetzung“ über die Paulskirche, wo die Walser/Bubis-Debatte ihren Ausgangspunkt nahm, den Börne-Platz und den anliegenden jüdischen Friedhof und den Hochbunker, der am Ort der Synagoge im Ostend errichtet worden ist, zum Polizeipräsidium mit der Skulptur für Fritz Bauer führte und inhaltlich von der Auseinandersetzung um den Antisemitismus der 70erund 80er-Jahre bis zu den Vorfällen der Affäre um die sogenannte „NSU 2.0“-Drohbriefe zeugte. Und andere Studierende haben aus Videomaterial des Jüdischen Museums eine Collage zusammengeschnitten, die die Bedeutung der Bühnenbesetzung aus der Sicht der damals beteiligten anschaulich werden lässt. Beide Projekte stellen aus meiner Sicht sehr eindrucksvolle Formen einer dramaturgischen Vermittlung dessen dar, was damals auf dem Spiel stand und was uns davon heute noch oder wieder beschäftigt.
Fragen: Dirk Frank
Dieser Beitrag ist in der Ausgabe 3/2021 (PDF) des UniReport erschienen.