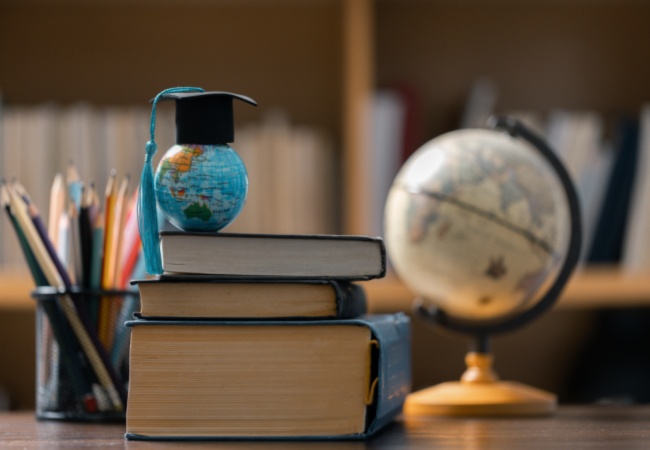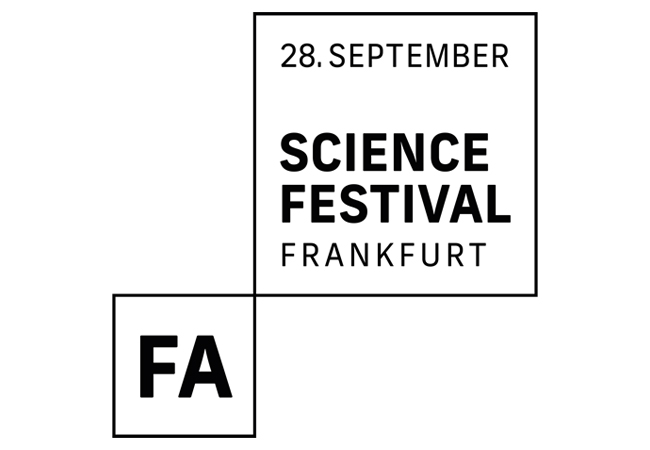Mehr als die Hälfte aller Deutschen ist laut Umfragen bereit, die deutsche Corona-Warn-App anzuwenden. Aber nur rund knapp ein Viertel der Bevölkerung hat die App auch installiert. Von welchen Faktoren es abhängt, ob Bürgerinnen und Bürger die Warn-App ablehnen, befürworten oder tatsächlich installieren, hat nun ein Team von Wirtschaftsinformatikern an der Goethe-Universität untersucht.
Die Corona-Warn-App der Bundesregierung hat Sympathie in der deutschen Bevölkerung: Rund 55 Prozent der Bürgerinnen und Bürger geben laut einer Studie der Goethe-Universität an, dass sie grundsätzlich bereit seien, die App zu installieren. Diese Sympathie motiviert aber nicht unbedingt zum Handeln: Nur 23 Prozent der möglichen Nutzerinnen und Nutzer haben die Warn-App aktuellen Downloads zufolge in der Anwendung.
Zwei Faktoren beeinflussen die Einstellung zur deutschen Corona-Warn-App und den Entschluss, sie zu installieren: die Lebenssituation der Befragten und ihr Wissen über die App. Dies hat nun eine repräsentative Umfrage unter mehr als 1.000 Teilnehmern unter der Leitung des Wirtschaftswissenschaftlers Prof. Dr. Oliver Hinz an der Goethe-Universität ergeben. Grundsätzlich bereit, die Warn-App zu installieren, sind etwa Menschen, die einer Risiko-Gruppe angehören (ca. 80 Prozent), häufig mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind (ca. 40 Prozent) oder die Einkäufe der Familie erledigen (ca. 73 Prozent). Auch wenn Familienangehörige und Freunde die App befürworten, steigert sich der App-Sympathie-Wert eines Probanden um den Faktor vier. Wer allerdings meint, das SARS-CoV-2-Virus könne ihm nichts anhaben, die Krankheit sei „wenig greifbar und wenig real“, ist auch nicht bereit, die App zu installieren.
Große Unsicherheit besteht in Bezug auf das gesicherte Wissen über die Warn-App, so ein Resultat der noch unveröffentlichten Studie. Dies gilt auch für Probanden, die gegenüber der App positiv eingestellt sind: Die Befragten wussten nicht, ob bei der Kontaktverfolgung GPS eingesetzt wird, ob sie zum Teilen eines positiven Testergebnisses verpflichtet sind oder ob ihre Daten auch für andere Zwecke verwendet werden können.
Wer darüber hinaus glaubt, die Corona-Warn-App diene der Kontrolle der Bevölkerung, sie verarbeite nicht nur anonymisierte Daten und greife auf private Daten des Smartphones zu, lehnt die App vermehrt ab. Oft gehen diese falschen Annahmen mit technischen Unkenntnissen einher oder auch mit dem Fehlen eines Geräts, das die technischen Voraussetzungen zur Installation der App erfüllt. Allein die Tatsache, dass die Probanden technisch in der Lage sind, die App zu installieren, erhöht ihre Bereitschaft um nahezu 74 Prozent.
Was hält nun Corona-Warn-App-Befürworter davon ab, ihre Bereitschaft in Handeln umzusetzen? Auch hier spielt das Wissen bzw. Nichtwissen über die App eine entscheidende Rolle. Viele App-Befürworter befürchten, dass die Funktion eine große Menge mobiler Daten verbraucht, sie beim Einhalten von Kontaktverboten oder einer verordneten Quarantäne kontrolliert oder ihnen die Kontakte vorschreibt, die sie im Fall eines positiven Tests informieren müssen.
Führt also mehr Information über die Warn-App zu einer größeren Akzeptanz und mehr tatsächlichen Anwendungen? Diese Annahme haben die Wissenschaftler selbst überprüft: Dazu führten sie Probanden, die die App ablehnen, 1- bis 2-minütige Info-Videos über die Warn-App vor. Ob die Clips nun über Datenschutzbedenken aufklärten, die Benutzung der App erläuterten oder an den emotionalen Zusammenhalt während der Pandemie appellierten – nach Ansicht der Videos änderte knapp ein Drittel der Probanden seine Einstellung zur App dahingehend, dass sie die Corona-App installieren wollten.
„Es gibt viel Halbwissen über die App“, sagt Wissenschaftliche Mitarbeiterin Valerie Carl. „Die Ergebnisse unserer Studie legen es nahe, dass eine weitere Informationskampagne der Bundesregierung die Bereitschaft für die Warn-App erhöhen könnte. Dabei sollte auch gezielt auf die Missverständnisse und Falschannahmen eingegangen werden, die viele davon abhält, die App zu nutzen.“
Dem Forschungsteam um den Wirtschaftsinformatiker und Informationsmanager Prof. Dr. Oliver Hinz gehörten Cristina Mihale-Wilson und K. Valerie Carl an.