Wie können wir Diversität verstehen, wie können wir sie schützen? Und was gewinnen wir, wenn wir Diversität ins Verhältnis setzen zum Universalen? Der Profilbereich Universality & Diversity widmet sich religiöser, kultureller und sprachlicher Vielfalt. Dabei wirken Sprachwissenschaften, Religionsforschung, Geschichtswissenschaften, Philosophie sowie Literatur-, Sprach- und Kulturwissenschaften, Politik- und Sozialwissenschaften interdisziplinär zusammen. Forschungsschwerpunkte sind: Dynamiken des Religiösen, Mehrsprachigkeit und machtvolles Handeln, Ästhetik: Materialität, Medialität, Potentialität sowie der Bauplan der menschlichen Sprache.

Im Forschungsprojekt »Dynamik des Religiösen« werden Prozesse von Verstehen, Missverstehen und Verständigung in religiösen Kontexten untersucht. Ein Gespräch über Märkte im Kaukasus und das Verschweigen von allem, was trennt.
Beim Verhältnis der drei monotheistischen Religionen denkt man eher an Feindschaft, Konflikt und Ausgrenzung als an Verstehen und Verständigung. Haben Sie gerade deshalb Verstehen als Zugang gewählt?
Birgit Emich: In meiner Kollegforschungsgruppe „Polyzentrik und Pluralität vormoderner Christentümer“, die ein Baustein des Clusters ist, beschäftigen wir uns schon länger mit Pluralität, was wiederum sehr viel mit Verstehen und Missverstehen zu tun hat. Wir befassen uns zum Beispiel mit konfessionellen Konflikten bis hin zu den Konfessionskriegen seit der Reformation. Und da lässt sich feststellen, dass die Forschung immer unsicherer wird in Bezug auf die Frage, wieviel die Leute voneinander gewusst und von den konfessionellen Frontlinien wirklich verstanden haben. Zum Beispiel wurden in der Mitte des 16. Jahrhunderts Hebammen im Elsass befragt, was sie bei der Nottaufe, die sie oft vornehmen mussten, unter der heiligen Dreieinigkeit verstanden. Eine Antwort lautete: ‚Kaspar, Melchior, Baltasar.‘ Daran sieht man, dass der Kenntnisstand der einfachen Leute sehr gering war. Vor diesem Hintergrund stellt sich umso mehr die Frage, warum die konfessionellen Unterschiede dann eine so große Rolle gespielt haben.
Man kann aber ergänzen: Wenn es schon innerhalb des Christentums solche Probleme gibt, dann kann man davon ausgehen, dass es zwischen den Religionen noch einmal ganz andere sind. Warum war die sogenannte Türkenangst im 16. Jahrhundert so riesig? Woher kam die Angst vor dem Islam, wenn man keine präzisen Vorstellungen davon hatte, wer man selbst ist? Hätte mehr Kenntnis geholfen, eine Verständigung herbeizuführen? Und umgekehrt: Sind Missverständnisse immer konfliktgeladen, führen sie immer zu Gewalt? Offenbar nicht.
Christian Wiese: Wir haben uns diesen Fragen interreligiösen Verstehens und Missverstehens u.a. auch von unserem LOEWE-Projekt „Religiöse Positionierung“ aus genähert: Dort ging es um die wechselseitige Wahrnehmung von Religionen, um die Begegnung, die Auseinandersetzung oder den Dialog mit anderen Geltungs- und Wahrheitsansprüchen auf der Grundlage der jeweils eigenen Position. In diesem Zusammenhang sind wir auch auf Phänomene kreativen „Missverstehens“ gestoßen, etwa auf die Tatsache, dass jüdische Gelehrte in der Moderne protestantische Deutungen der biblischen Prophetie übernahmen, sie jedoch im Zuge dieser Aneignung im Sinne ihres eigenen Selbstverständnisses umdeuteten und nutzten, um die Fortexistenz und Überlegenheit des Judentums zu begründen.
Man kann aber ergänzen: Wenn es schon innerhalb des Christentums solche Probleme gibt, dann kann man davon ausgehen, dass es zwischen den Religionen noch einmal ganz andere sind. Warum war die sogenannte Türkenangst im 16. Jahrhundert so riesig? Woher kam die Angst vor dem Islam, wenn man keine präzisen Vorstellungen davon hatte, wer man selbst ist? Hätte mehr Kenntnis geholfen, eine Verständigung herbeizuführen? Und umgekehrt: Sind Missverständnisse immer konfliktgeladen, führen sie immer zu Gewalt? Offenbar nicht.
Christian Wiese: Wir haben uns diesen Fragen interreligiösen Verstehens und Missverstehens u.a. auch von unserem LOEWE-Projekt „Religiöse Positionierung“ aus genähert: Dort ging es um die wechselseitige Wahrnehmung von Religionen, um die Begegnung, die Auseinandersetzung oder den Dialog mit anderen Geltungs- und Wahrheitsansprüchen auf der Grundlage der jeweils eigenen Position. In diesem Zusammenhang sind wir auch auf Phänomene kreativen „Missverstehens“ gestoßen, etwa auf die Tatsache, dass jüdische Gelehrte in der Moderne protestantische Deutungen der biblischen Prophetie übernahmen, sie jedoch im Zuge dieser Aneignung im Sinne ihres eigenen Selbstverständnisses umdeuteten und nutzten, um die Fortexistenz und Überlegenheit des Judentums zu begründen.
Was ist der Impuls für diese Prozesse: Will man die eigene Identität bestimmen, um sich gegenüber den anderen Religionen abzugrenzen? Oder geht es darum, Macht auszuüben?
Wiese: Das hängt davon ab, wer in der Minderheit oder Mehrheit ist. Das europäische Judentum im 19. Jahrhundert argumentierte eigentlich immer mit Blick auf die eigene Existenz als diskriminierte Minderheit in der christlichen Mehrheitsgesellschaft. Aber gleichzeitig fanden andere Prozesse statt: Jüdische Intellektuelle suchten auch nach Vorbildern und Modellen, um das Judentum selbst zu modernisieren, und fanden dann in protestantischen Formen etwas, das kulturell erstrebenswert schien. Da ging es auch darum, die eigene Identität zu verändern und zu stärken.
Sie konzentrieren sich auf fünf Forschungsschwerpunkte. In einem geht es um den Prozess des Übersetzens zwischen den Religionen.
Wiese: Bernhard Jussen, Ömer Oszoy, Rebekka Voss und einige weitere Kolleginnen und Kollegen bearbeiten dieses Thema in mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Kontexten. Da wird gefragt: Was passiert, wenn man die Heilige Schrift in eine andere Sprache übersetzt, wenn christliche Autoren koranische Texte ins Lateinische übersetzen, wenn Begriffe und Konzepte in die eigene Vorstellungswelt übertragen werden? Welche Formen der Umdeutung oder Aneignung finden dann statt?
Emich: Wobei wir übersetzen auch im weiteren Wortsinn verstehen. Man kann die gleiche religiöse Praxis in Bildern ausdrücken, in Texten beschreiben und sie performativ vollziehen. Diese Form der Übersetzung, also etwa die Verschriftlichung eines religiösen Brauchs oder die bildhafte Darstellung einer liturgischen Vorschrift, sind auch Übersetzungsvorgänge, die uns interessieren. Man könnte sie Medienwechsel nennen.
Emich: Wobei wir übersetzen auch im weiteren Wortsinn verstehen. Man kann die gleiche religiöse Praxis in Bildern ausdrücken, in Texten beschreiben und sie performativ vollziehen. Diese Form der Übersetzung, also etwa die Verschriftlichung eines religiösen Brauchs oder die bildhafte Darstellung einer liturgischen Vorschrift, sind auch Übersetzungsvorgänge, die uns interessieren. Man könnte sie Medienwechsel nennen.
Ihr Kollege, der Historiker Hartmut Leppin, erarbeitet in diesem Zusammenhang ein Glossar.
Emich: Das „Glossar“ trägt dem Umstand Rechnung, dass bestimmte Phänomene sowohl in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen als auch von den historischen Akteurinnen und Akteuren unterschiedlich benannt werden. Und dass man sich erst einmal klarwerden muss, wer eigentlich was meint. Mit Gott, Wahrheit, Religion meinen eben nicht immer alle das gleiche.
Wollen Sie so eine gemeinsame Sprache finden?
Emich: Es war unsere ursprüngliche Idee, eine gemeinsame Forschungssprache zu schaffen. Damit würden wir aber der Vielfalt unserer empirischen Bestände nicht gerecht. Unser Ziel muss es sein, mit dem Glossar ein Instrumentarium zu entwickeln, um diese Vielfalt zu verarbeiten. Ich würde daher eher von einem Thesauraus, eine Art historisch- vergleichendem Wörterbuch, als von einem Glossar sprechen. Dieser Schritt scheint uns schon anspruchsvoll genug zu sein.
Spielt dabei eine Rolle, dass der Inhalt von Religion auch mit dem Nichtsagbaren, mit dem Nicht-Übersetzbaren zu tun hat?
Emich: Ja, das geht schon los bei so etwas Fundamentalem wie dem Gottesbegriff. Wie benennt man Gott? Das ist im interreligiösen Kontakt natürlich ein ganz großes Problem. Und wenn wir auf die Missionsgeschichte blicken, sehen wir, dass christliche Missionare Gott verschieden benennen – je nachdem, in welchem kulturellen Raum sie wirken. Die in China im 16. und 17. Jahrhundert tätigen Jesuiten finden andere Formulierungen als diejenigen, die im amerikanischen Raum unterwegs sind.
Wiese: Interessant ist auch, dass diese Prozesse wiederum Rückwirkungen auf die eigene Sprache haben. Unsere Kollegin Catherina Wenzel ist im Rahmen ihrer Forschung zur persischen Stadt Isfahan im 18. Jahrhundert auf einen italienischen Missionar gestoßen, der sich im Kontext des schiitischen Islam bewegt. Sein eigenes Selbstverständnis bleibt von der Begegnung mit dem Islam und anderen religiösen Gruppen nicht unbeeinflusst, und das spiegelt sich auch in seinen Berichten nach Rom wider.
Emich: An den Kontaktgrenzen gibt es eine große Durchlässigkeit. Viele Missionare sagen: Wenn wir auch nicht dasselbe glauben, können wir doch alle am selben Abendmahl teilnehmen. Das ist etwas, das uns interessiert: Fördert die alltägliche Pragmatik im Umgang miteinander vielleicht nicht das gelehrte religiöse Verstehen, aber doch die Bereitschaft, miteinander umzugehen?
Wiese: Interessant ist auch, dass diese Prozesse wiederum Rückwirkungen auf die eigene Sprache haben. Unsere Kollegin Catherina Wenzel ist im Rahmen ihrer Forschung zur persischen Stadt Isfahan im 18. Jahrhundert auf einen italienischen Missionar gestoßen, der sich im Kontext des schiitischen Islam bewegt. Sein eigenes Selbstverständnis bleibt von der Begegnung mit dem Islam und anderen religiösen Gruppen nicht unbeeinflusst, und das spiegelt sich auch in seinen Berichten nach Rom wider.
Emich: An den Kontaktgrenzen gibt es eine große Durchlässigkeit. Viele Missionare sagen: Wenn wir auch nicht dasselbe glauben, können wir doch alle am selben Abendmahl teilnehmen. Das ist etwas, das uns interessiert: Fördert die alltägliche Pragmatik im Umgang miteinander vielleicht nicht das gelehrte religiöse Verstehen, aber doch die Bereitschaft, miteinander umzugehen?
Sie sehen sich ja deshalb auch religiöse Praktiken an.
Emich: Ja, aber nicht nur. Nehmen Sie zum Beispiel das Marktgeschehen im Kaukasus. In einem ethnologischen Projekt fragen Susanne Fehlings und Roland Hardenberg, wie Menschen verschiedener Religionen miteinander Handel treiben können. Die Antwort ist: indem sie ihre Religionen gar nicht ansprechen. Menschen haben sich zu allen Zeiten und in allen Religionen auch immer Freiräume gelassen, in denen sie Dinge nicht thematisieren. Das gehört auch zu dem Bereich des Sagbaren und Unsagbaren. Wir fragen uns dann, welche Konsequenzen hat das? Wir gehen davon aus, dass, wenn man lange genug handelt mit jemandem, von dem es heißt, dass er eigentlich der Verdammung anheimfallen muss, man diese Aussage eines Tages anders bewerten wird.
Wiese: Verflechtung und Verflochtenheit, das sind zentrale Begriffe für uns. Die drei Religionen waren eben nie kontaktlos nebeneinander, sondern hatten in ihrem Denken und Zusammenleben seit dem frühen Mittelalter ständig miteinander zu tun. Judentum und Islam waren vielfältig miteinander verflochten, zum Beispiel in ihren mystischen Traditionen – der Kabbala und dem Sufismus. Sie stellten sich dieselbe Frage: Wie macht man das eigentlich, Kontakt zum Göttlichen herstellen – durch Versenkung in Texte, durch Tanz, Ekstase, durch Bewegung im Gebet? Hier gab es zahlreiche Berührungspunkte.
Wiese: Verflechtung und Verflochtenheit, das sind zentrale Begriffe für uns. Die drei Religionen waren eben nie kontaktlos nebeneinander, sondern hatten in ihrem Denken und Zusammenleben seit dem frühen Mittelalter ständig miteinander zu tun. Judentum und Islam waren vielfältig miteinander verflochten, zum Beispiel in ihren mystischen Traditionen – der Kabbala und dem Sufismus. Sie stellten sich dieselbe Frage: Wie macht man das eigentlich, Kontakt zum Göttlichen herstellen – durch Versenkung in Texte, durch Tanz, Ekstase, durch Bewegung im Gebet? Hier gab es zahlreiche Berührungspunkte.
Ihr Projekt untersucht aber auch die Missverständnisse, die Gründe für Konflikte.
Emich: Sehen wir uns noch einmal das Beispiel der kaukasischen Märkte an: Der Umstand, dass man sich überhaupt nicht versteht, weil man nicht weiß, was der andere denkt, führt nicht zwingend zu Konflikten. Man muss also davon wegkommen zu denken, wir müssen nur möglichst viel voneinander wissen, dann werden wir uns schon verstehen.
Wiese: In der Gegenwart gibt es in Bezug auf den interreligiösen Dialog den Versuch, Konflikte bewusst auszusparen. Das Projekt „Weltethos“ beruht zum Teil auf diesem Konzept. Da einigen sich Religionen auf die Vorstellungen und ethischen Werte, die alle teilen. Und das, was sie trennt, blenden sie bewusst aus. Weil die Differenz unüberwindlich ist.
Wiese: In der Gegenwart gibt es in Bezug auf den interreligiösen Dialog den Versuch, Konflikte bewusst auszusparen. Das Projekt „Weltethos“ beruht zum Teil auf diesem Konzept. Da einigen sich Religionen auf die Vorstellungen und ethischen Werte, die alle teilen. Und das, was sie trennt, blenden sie bewusst aus. Weil die Differenz unüberwindlich ist.
»Das Verstehen ist der Kontaktpunkt«
Das bedeutet ja nichts Anderes, als dass Religionen Systeme sind, die einen Allgemeingültigkeitsanspruch erheben.
Wiese: Im jüdischen Kontext gibt es seit dem Mittelalter eine interessante Lösung: Juden waren ja nie mit eigener Macht ausgestattet und mussten damit umgehen, dass sie in einer von anderen monotheistischen Religionen dominierten Umwelt lebten. Jüdische Gelehrte haben dann ein inklusives Absolutheitsverständnis entwickelt: ‚Wir sind eigentlich die wahre Religion, aber Christentum und Islam haben aus der jüdischen Tradition wesentliche Elemente aufgenommen. Als machtvolle Entitäten können sie sie in der Welt verbreiten. Am Ende der Geschichte wird sich aber zeigen, dass die jüdische Religion diese Werte am reinsten verkörpert und bewahrt hat‘. Die jüdische Religion braucht also keinen exklusiven Wahrheitsanspruch und könnte ihn auch nicht durchsetzen.
Sie gehen mit Ihrer Fragestellung auch in die Gegenwart und fragen nach dem Verhältnis von Religion und Digitalität.
Emich: Ein interessanter Aspekt ist etwa: Wie verändert sich das Rederecht durch das Internet? Für den islamischen Bereich zum Beispiel untersucht Armina Omerika, wie sich die Vielzahl der Redner und Rednerinnen im Internet erhöht hat. Wer hat Autorität, wem glaube ich – die Vielzahl der Sprechenden hat ein größeres Spektrum geschaffen.
Gibt es etwas, das Ihnen an Ihrem Forschungsthema besonders wichtig ist?
Wiese: Mich hat schon immer die Wahrnehmung des Anderen interessiert. Und auch der Perspektivwechsel in diesem Zusammenhang und Fragen des Dialogs: Ist Verstehen eigentlich nur möglich, indem man Konflikte herabspielt und einen Konsens herbeiführt? Oder können wir Differenz und Konflikte bearbeiten, indem wir den Anderen in seiner ganz anderen Wahrheit anerkennen? Ich beschäftige mich etwa mit jüdischen Denkern im amerikanischen Kontext, die von der Polyphonie von Wahrheiten sprechen. Die Frage ist: Verfügen die drei Religionen über Potenziale der Pluralismusfähigkeit, die für die Gegenwart von Bedeutung sind?
Emich: Diese Überwindung der Containervorstellung von Religionen – das ist auch mir wichtig. Die Lebensrealität war doch oft so, dass Menschen sich gar nicht so wahrgenommen haben, als würden sie in abgeschotteten religiösen Containern sitzen. Es lohnt sich deshalb sehr, von diesen interreligiösen Fragestellungen und Befunden aus nochmal zurück auf die binnenreligiösen Probleme zu sehen. Vor diesem Hintergrund lassen sich religiöse Grenzziehungen allgemeiner Art in allen Epochen und in allen Konstellationen besser verstehen. Mit dem Verstehensbegriff rücken wir etwas ins Zentrum, was sowohl Konflikte grundiert als auch Zusammenleben möglich macht. Das Verstehen ist der Kontaktpunkt, von dem aus sich gesellschaftliche Prozesse in verschiedene Richtungen entwickeln können.
Emich: Diese Überwindung der Containervorstellung von Religionen – das ist auch mir wichtig. Die Lebensrealität war doch oft so, dass Menschen sich gar nicht so wahrgenommen haben, als würden sie in abgeschotteten religiösen Containern sitzen. Es lohnt sich deshalb sehr, von diesen interreligiösen Fragestellungen und Befunden aus nochmal zurück auf die binnenreligiösen Probleme zu sehen. Vor diesem Hintergrund lassen sich religiöse Grenzziehungen allgemeiner Art in allen Epochen und in allen Konstellationen besser verstehen. Mit dem Verstehensbegriff rücken wir etwas ins Zentrum, was sowohl Konflikte grundiert als auch Zusammenleben möglich macht. Das Verstehen ist der Kontaktpunkt, von dem aus sich gesellschaftliche Prozesse in verschiedene Richtungen entwickeln können.


Die Historikerin Prof. Dr. Birgit Emich und der Religionswissenschaftler Prof. Dr. Christian Wiese sind das Sprecherteam des Forschungsprojekts Dynamiken des Religiösen.
Dynamiken des Religiösen. Prozesse des Verstehens, des Missverstehens und der Verständigung
Goethe-Universität Frankfurt
Beteiligte Institutionen – Partner:
Forschungskolleg Humanwissenschaften (Bad Homburg), Buber-Rosenzweig-Institut für jüdische Geistes- und Kulturgeschichte der Moderne und Gegenwart, Institut für Religionsphilosophische Forschung, Frobenius-Institut für Kulturanthropologische Forschung, Frankfurt-Tel Aviv Center fort he Study of Religious and Interreligious Dynamics, Arbeitsstelle „Politische Philosophie und Rechtsphilosophie des Mittelalters und der Neuzeit“ am Institut für Philosophie (FB 08), Institut Franco-Allemand des Sciences Historiques et Sociales (IFRA).

Im neuen Bachelorstudiengang »Afrikanische Sprachen, Medien und Kommunikation« geht es neben den afrikanischen Sprachwissenschaften auch um das moderne Afrika. Die hohe Nachfrage spricht für das Konzept.
Manchmal fügen sich Dinge zur richtigen Zeit am richtigen Ort – wie etwa beim neuen Bachelorstudiengang »Afrikanische Sprachen, Medien und Kommunikation«. Den Impuls dazu erhielt der Afrikawissenschaftler Axel Fanego Palat schon vor Jahren, als er mit Afrikanisten außerhalb der Wissenschaft zusammenkam. Die Botschaft: Es fehlt uns an Wissen über das heutige Afrika. Wie verständigen sich etwa Afrikanerinnen und Afrikaner, die von Haus aus mehrsprachig sind, in der europäischen Diaspora? Welche Rolle spielt Social Media in einem Kontinent mit mündlicher Tradition? Und wie prägend sind Postkolonialismus und Migration?
Das Interesse am heutigen Afrika mag jungen Menschen nicht nur Berufsfelder eröffnen, bemerkte Fanego Palat damals; es fordert auch sein eigenes, sogenanntes »Kleines Fach« heraus. Afrikanische Sprachwissenschaften als »rein sprachbeschreibende Disziplin reicht nicht mehr«, ist er überzeugt. Da passt es gut, dass auch der Mainzer Afrikaforscher Nico Nassenstein über eine Neuausrichtung seines Fachs nachdenkt und sich die Forschungsschwerpunkte an den beiden Professuren ergänzen. Gemeinsam ist man stärker – und kompetent genug für einen in Deutschland einzigartigen Studiengang. Rückenwind bekommt das Projekt zudem durch die Zusammenarbeit der Universitäten Frankfurt und Mainz (und der TU Darmstadt) in der strategischen Allianz der Rhein-Main-Universitäten (RMU): Der Verbund fördert gezielt die Zusammenarbeit über seine beiden Initiativfonds für Forschung und für Lehre. Also bohren die beiden Professoren gemeinsam »ein dickes Brett« und entwickeln ein Konzept über die Bundesländergrenzen und bürokratischen Hürden hinweg.
Der neue Bachelorstudiengang, in dem ein Auslandsaufenthalt empfohlen wird, ist interdisziplinär angelegt. Studiert werden zwei afrikanische Sprachen, afrikanistische linguistische Praxis mit Inhalten der Soziolinguistik, der digitalen und interkulturellen Kommunikation. Dank digitaler Lehrformate hält sich das Pendeln in Grenzen und ermöglicht es auch, Lehrende aus Afrika einzubeziehen.
Angedockt ist der neue Studiengang an ein neues, vom Bund gefördertes Forschungsprojekt, das ebenfalls gemeinsam von den Unis Frankfurt und Mainz getragen wird: das interdisziplinäre, internationale Forschungsprojekt Cultural Entrepreneurship and Digital Transformation in Africa and Asia (CEDITRAA).
Wie verlief der Start? Die Nachfrage scheint das Konzept zu bestätigen: Fast 40 junge Menschen haben im Herbst das Studium aufgenommen. »Sie sind sehr vielfältig, hochinformiert und kritisch«, ist Fanego Palat beeindruckt. Wie etwa Joel Amine, der auf der Suche nach einer Alternative zu seinem Jurastudium war. Afrikanische Sprachwissenschaften kamen für den Sohn eritreischer Eltern nicht infrage – ihm erschien das Studium zu sprachlastig, er suchte mehr Inhalte zum modernen Afrika. Als Amine vom neuen Studiengang erfuhr, wusste er: »Das ist es. Das hat Bezug zu mir.« Joel ist sich sicher, dass es Menschen braucht, die Brücken bauen können zu Europas Nachbarkontinent, weil sie sich auskennen mit kolonialer und postkolonialer Geschichte und dem Potenzial des Kontinents; mit Flüchtlingsschicksalen und Social-Media-Boom. Und die auch afrikanische Sprachen beherrschen, auch wenn das Vokabel-Lernpensum gerade enorm ist, wie Amine zugibt: Das erste Semester hat seine Erwartungen voll erfüllt.
»Das hat Bezug zu mir«
CEDITRAA-Forschungsprojekt: Wie die Digitalisierung die kulturelle Produktion in Afrika und Asien prägt.
Seit 2021 gibt es an den Universitäten Frankfurt und Mainz das Forschungsprojekt Cultural Entrepreneurship and Digital Transformation in Africa and Asia (CEDITRAA), das gemeinsam mit dem Kooperationspartner Pan-Atlantic University in Lagos in Nigeria und weiteren Partnern in Südkorea durchgeführt wird. Gemeinsam erforschen sie die Folgen der Digitalisierung für die kulturelle Produktion in Afrika und Asien, mit einem Fokus auf Musik und Film. Die Arbeitshypothese ist dabei, dass durch die Digitalisierung in Städten wie Lagos, Istanbul, Mumbai oder Seoul neue Zentren der Kulturproduktion jenseits der klassischen Zentren wie Paris, London, New York oder Los Angeles entstanden sind.
Dazu arbeitet die Filmwissenschaft mit Wirtschaftswissenschaften, Kulturanthropologie, Linguistik, Afrika- und Asienstudien zusammen. Entsprechend breit ist auch die praktizierte Methodenvielfalt: Sie reicht von Feldforschung und teilnehmender Beobachtung über ökonomische Studien bis hin zu digitalen Recherchen.
Was alle Beteiligten eint: das Interesse, den Blickwinkel der europäischen Medien- und Kulturindustrien zu erweitern. Welche Lektionen halten die afrikanischen und asiatischen Filmindustrien bereit? Wie verändern sich kulturelle Räume im Zuge der Digitalisierung der Produktion von Film und Musik? Und was ist überhaupt globale Filmkultur?
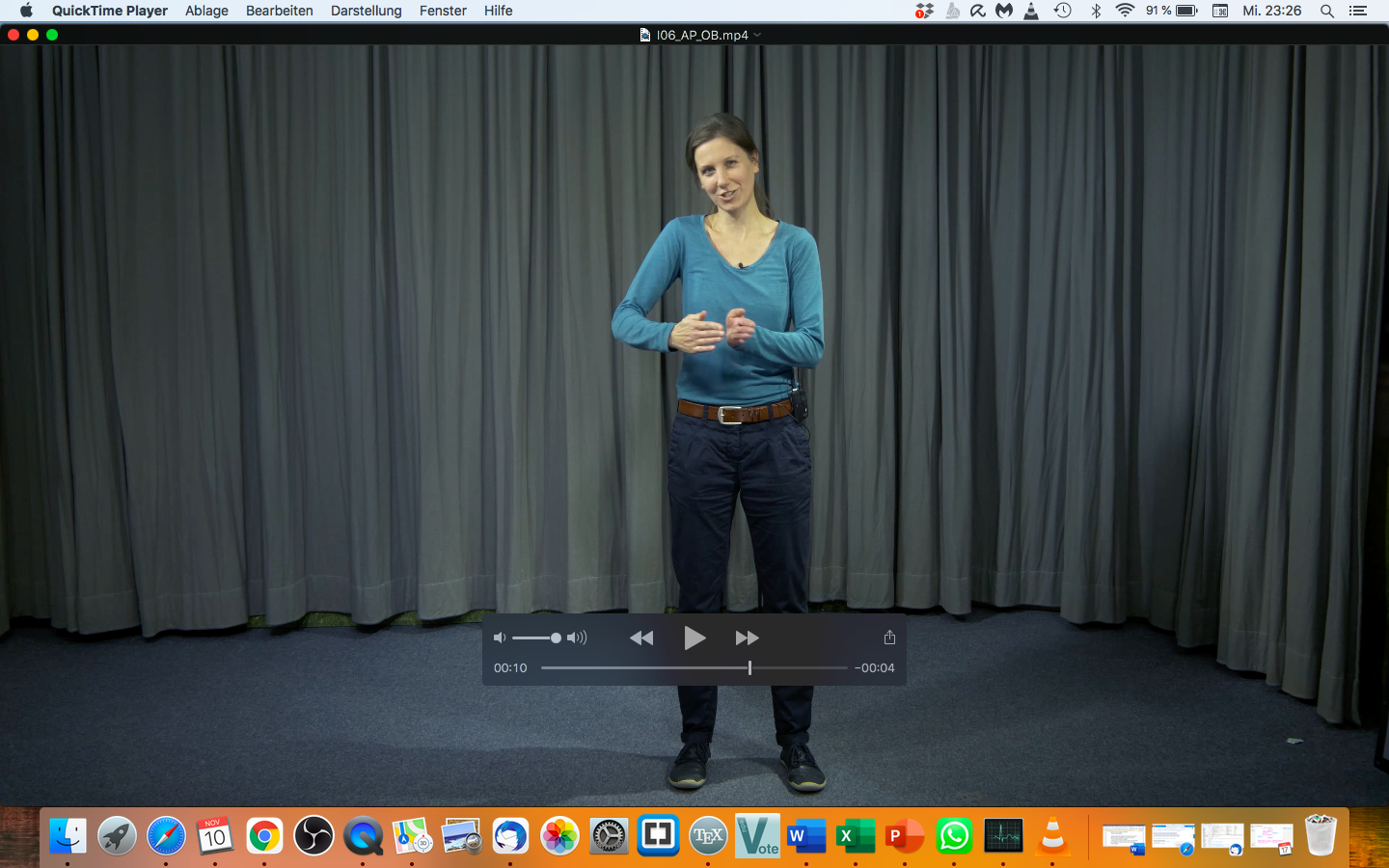
Wenn wir sprechen, begleiten wir unsere Aussagen durch Gesten. Wie das Zusammenspiel zwischen Lautsprache und Motorik der Hände funktioniert, will ein neues Schwerpunktprogramm untersuchen.
»Fahren Sie die nächste Straße rechts (zeigt nach rechts), dann die dritte links (zeigt nach links), bis Sie an einen Kreisel kommen (beschreibt mit der Hand einen Kreis). Auf der rechten Seite sehen Sie eine Einfahrt (beschreibt mit der Hand einen aufrecht stehenden Bogen), da geht es zum Museum.« – Man stelle sich diese Wegbeschreibung mal mit, mal ohne begleitende Gesten vor. Schnell wird deutlich: Gesten gehören zur Alltagskommunikation, sie erleichtern das Übermitteln von Informationen, indem sie der akustischen Ebene einen visuellen Kanal hinzufügen. Wer eine solche Wegbeschreibung erhält, kann sich vor dem inneren Auge mehr vorstellen und kommt nun wahrscheinlich leichter zum Ziel.
Doch wie funktioniert die Kommunikationsebene der Gesten? Wo und wann haben wir diese »Sprache« erlernt? Wie entscheiden wir, ob, wann und wie wir gestikulieren? Und wie lässt sich die Semantik der Gesten in ein System bringen, das sich verallgemeinern ließe? Bis vor Kurzem wurden visuelle Bedeutungsbeiträge nicht in der formalen Linguistik behandelt, sondern vornehmlich in den Kommunikationswissenschaften. Auch Rhetorik, Semiotik und Psychologie kennen die Gestik schon lange als Gegenstand ihrer Betrachtungen. Nicht zu vergessen die längst etablierte Forschung zur Gebärdensprache.
In der theoretischen Linguistik jedoch sind Form und Funktion von Gesten bislang kaum untersucht. Das soll sich nun ändern: Ein DFG-Schwerpunktprogramm unter Federführung der Goethe-Universität will die bestehenden Erkenntnisse aus verschiedenen Fächern zusammenführen und mit der Linguistik vernetzen – wobei es nicht nur um Gestik geht, sondern auch um andere visuelle Formen der Bedeutungsübermittlung. »Das Thema nimmt nun auch in meiner Disziplin Fahrt auf«, freut sich Cornelia Ebert, Professorin für Semantik an der Goethe-Universität, die das Schwerpunktprogramm zusammen mit dem Gebärdensprachforscher Prof. Markus Steinbach von der Universität Göttingen beantragt hat und für dessen Koordination zuständig sein wird.
Die visuellen Kommunikationsformen, auf die das Schwerpunktprogramm fokussieren wird, sind die Gestik die Gebärdensprachen, die Tierkommunikation, didaktische und klinische Aspekte, die Mensch-Maschine-Interaktion und die visuellen Studien, also die Kommunikation mit Bildern und Filmen. Zu jedem Teilthema wurden spannende Projekte beantragt – und drei werden an der Goethe-Universität gefördert, nachdem sie im April 2021 bewilligt worden sind. Der Linguist Prof. Frank Kügler etwa nimmt gemeinsam mit einer Kollegin in Barcelona das Zusammenspiel von Intonation und Gesten in den Blick. Und die Informatiker Dr. Andy Lücking und Prof. Alexander Mehler wollen die Bedeutung von Gesten mithilfe Künstlicher Intelligenz erfassen. Die Förderdauer beträgt zwei mal drei Jahre, zur Verfügung stehen zwölf Millionen Euro.
Als Semantikerin, die aus der Computerlinguistik kommt, interessiert sich Cornelia Ebert vor allem dafür, wie sich die Bedeutung einer Äußerung aus Geste und Sprache zusammensetzt und wie man dies in einem Modell abbilden kann. Mithilfe der bereits vorhandenen Expertise, die das Schwerpunktprogramm versammelt, soll die theoretische Linguistik »einen ganz großen Schritt weiterkommen«. Ziel sei ein Werkzeugkasten für die theoretische Linguistik, der hilft, das Phänomen der Gestik besser erfassen zu können und daraus eine Theorie abzuleiten. Bislang fehle es schlicht am »formalen Apparat«.
Am Institut für Kognitionswissenschaft in Osnabrück hat Ebert untersucht, wie sich die zeitliche Abfolge von Geste und Sprache – Ebert nennt das »Alignierung« – auf die Bedeutung auswirkt. »Dass Geste und Sprache zeitlich aligniert sind, wissen wir spätestens seit den 1960er Jahren«, sagt Ebert. Sie sieht in Gesten keineswegs in erster Linie einen Ausdruck von Gefühlen, denn sie transportierten häufig »harte Fakten« – wie im obigen Beispiel einer Wegbeschreibung.
Die Wegbeschreibung ist ein gutes Beispiel dafür, dass Gesten von sehr unterschiedlichem Charakter sein können: Manche sind deiktisch, also zeigend: Diese Kategorie bildet sich beim kindlichen Spracherwerb sehr früh heraus: »Sobald ein Kind auf etwas zeigt und sagt >da!˂, geht es so richtig los«, sagt Ebert. Erwachsene nutzen diese Art von Geste auch in abstraktem Sinne und zeigen auf Gegenstände oder in Richtungen, die im Augenblick gar nicht konkret vorhanden sind. Gesten wiederum, die in ihrer Bedeutung fest verankert sind wie ein Lexem, nennt man konventionalisierte Gesten. In diese Kategorie gehören etwa Beleidigungsgesten wie der »Stinkefinger« oder das Aneinanderreiben von Zeigefinger, Mittelfinger und Daumen mit der Bedeutung »Geld«. Von ikonischen Gesten spricht man, wenn eine Handlung oder ein Gegenstand nachgeahmt wird – im Beispiel der Wegbeschreibung ist das beim Kreisel und beim Torbogen der Fall. Und dann gibt es schließlich noch Gesten mit metaphorischer Bedeutung und solche, die die gesprochene Sprache rhythmisieren oder Akzente setzen sollen. Allen Gestentypen ist gemeinsam, dass sie sprachliche Äußerungen akzentuieren, modifizieren und strukturieren können, manche fügen auch neue Informationen hinzu. Sie lenken den Blick auf bestimmte Komponenten der Äußerung und können diese mitunter präzisieren – wie im Beispiel der Wegbeschreibung, wo wir erfahren, dass es sich bei der Einfahrt offenbar um einen Torbogen handelt. Nicht möglich ist jedoch, die Aussage des Gesprochenen rein mit einer Geste zu negieren. Die strukturierende Funktion von Gesten lässt sich wohl am ehesten mit den prosodischen Möglichkeiten der gesprochenen Sprache wie Betonung, Lautstärke und Tempo vergleichen.
In ihrem eigenen SPP-Projekt, in dem Ebert gemeinsam mit der Universität Wuppertal gefördert wird, geht es um die erzählerische Perspektive, die Gesten in die Kommunikation einbringen: Wie machen Gesten deutlich, ob der Sprecher in der Beobachterrolle (Observer Viewpoint) oder in der Rolle des Beteiligten (Character Viewpoint) ist? Berichtet eine Person über ein Geschehen ohne eigene Beteiligung, wird der Raum vor ihrem Körper zur Bühne, die Hände sind die Schauspieler. Ist der Erzähler selbst Akteur, so spielen seine Hände seine Hände, er selbst schlüpft pantomimisch in die Rolle des Akteurs. »Die gestische Perspektive deckt sich nicht immer mit der der sprachlichen Erzählung. Wir wollen herausfinden, wie das auf den Zuhörer wirkt und warum das nicht unbedingt kongruent sein muss«, beschreibt Ebert ihr Projekt. In einem Experiment spielt eine Schauspielerin unterschiedliche Varianten vor. »Überraschend war: Die Probanden stören sich nicht daran, wenn sprachliche und gestische Perspektive voneinander abweichen«, berichtet Ebert. Warum das so ist, darüber soll das Projekt Aufschluss geben.
Die Schwerpunktprogramme der DFG sind darauf ausgelegt, wissenschaftliche Grundlagen besonders aktueller oder sich gerade bildender Forschungsgebiete zu untersuchen, wobei Interdisziplinarität eine große Rolle spielt. Im SPP »Visuelle Kommunikation« haben sich so unterschiedliche Disziplinen wie Neurologie, Didaktik, Informatik und eben Linguistik zusammengetan. So können bereits vorhandene Erkenntnisse ausgetauscht und nutzbar gemacht werden – etwa das Wissen darum, wie sich Sprache und Gestik nach einer Hirnschädigung verändern: Es gibt zwar Menschen, die nicht mehr fehlerfrei sprechen können, die ikonischen Gesten aber nach wie vor beherrschen – und umgekehrt. In der Regel aber erfolgt die Wahrnehmung von Sprache und Gestik doch über ähnliche Mechanismen, was dazu führt, dass Menschen sich oft nicht erinnern können, ob sie eine Information via Geste oder via Sprache erhalten haben. Interessant ist auch, dass blinde Kinder ebenfalls über gewisse Gesten kommunizieren, unabhängig davon, ob ihr Gegenüber sehen kann oder nicht.
Dass vor allem Südländer »mit Händen und Füßen« sprechen, wie der Volksmund sagt, das ist jedenfalls eindeutig ein Klischee. Zwar gibt es zwischen den Sprachgemeinschaften durchaus Unterschiede, was bestimmte Gesten bedeuten, ja, manchmal gibt es auch ein innerfamiliäres Repertoire. Das ist wissenschaftlich bereits belegt in einer Dissertation von 1998: Südländer kommunizieren nicht mehr mit den Händen als Leute aus dem Norden; allerdings machen sie dabei größere Bewegungen.
(asa)
Mit Händen Sprache formen

Nachgefragt bei...
Cornelia Ebert
Welches Problem wollen Sie mit dem SPP ViCom gern besser verstehen?
Was Gestik, Mimik und andere visuell basierte Phänomene zur Bedeutung gesprochener Sprache beitragen und wie rein »visuelle Sprachen«, also Gebärdensprachen, funktionieren und was sie von gesprochenen Sprachen unterscheidet.
Was ist Ihnen daran persönlich wichtig?
Für die Sprachwissenschaft erhoffe ich mir, dass sie ihre Theorien und das Methodenrepertoire durch die Behandlung eines neuen Phänomenbereichs – der formalen Analyse von anderen Kommunikationsmitteln außerhalb der geschriebenen und gesprochenen Sprache – erweitern kann und so in der Lage ist, sprachliche Kommunikation in ihrer ganzen Komplexität zu erfassen.
Außerdem ist mir wichtig, dass alle Wissenschaftsrichtungen, die derzeit an diesen Phänomenen arbeiten (unter anderem Linguistik, Semiotik, Bild- und Filmwissenschaften, Didaktik, Informatik, Psychologie, Neurowissenschaften, Primatenforschung) zusammenfinden und sich austauschen. Ich bin überzeugt, dass nicht nur unser Feld, die theoretische Linguistik, von diesem Austausch enorm profitieren wird.
Was ist ein Etappenziel?
Ein gemeinsames Daten- und Methodenrepertoire für alle beteiligten Disziplinen aufzustellen und eine Grundlage für einen wissenschaftlichen Austausch zu schaffen, der gemeinsame Standards für die Erhebung und Analyse von Daten und die Entwicklung neuer Theorien schafft.
Was ist die größte Hürde?
Es gibt noch keine einheitliche linguistische Theorie und nicht einmal adäquate formale Werkzeuge, um visuelle Phänomene in derselben präzisen Weise beschreiben und modellieren zu können wie andere sprachliche Phänomene. Einen solchen formalen Apparat zu entwickeln, ist eine große Herausforderung.
Gibt es eine Erkenntnis, die Sie besonders geprägt hat und die Sie in dieses Projekt quasi als »Rüstzeug« mitnehmen?
Die Einsicht, dass Gesten genauso wie Sprache eine Bedeutung beitragen können und sich die Gestenbedeutung auf ganz besondere Weise mit Sprachbedeutung verbinden kann.
Prof. Dr. Cornelia Ebert ist Professorin am Institut für Linguistik am Fachbereich Neuere Philologien.
Unser Forschungsprofil: Raum für gute Antworten
Mit sechs Profilbereichen will die Goethe-Universität ihre Kompetenzen stärker bündeln.

