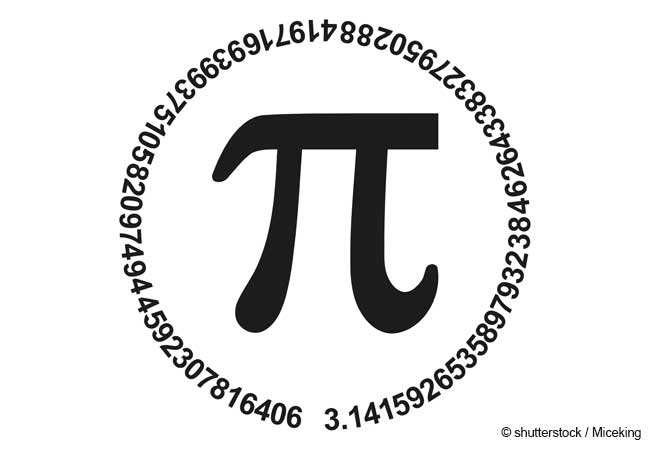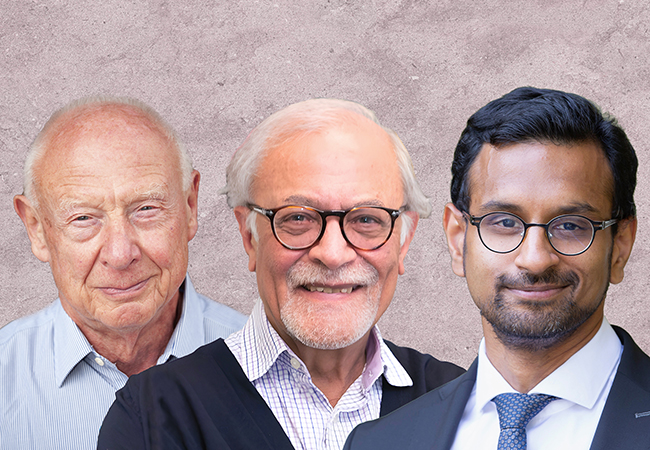Im Interview mit dem Kollegen Hans Peter Klein im letzten UniReport (2/2015) wurde behauptet, dass wir in Deutschland einen Irrweg beschritten, indem wir die Quote akademisch gebildeter Personen in den jüngeren Jahrgängen systematisch erhöhen. Darauf möchten wir antworten.
Derzeit zählen wir hierzulande rund 45 Millionen Beschäftigte. Nach Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) wird diese Zahl bis 2050 bei konstanten Erwerbsquoten und ohne zusätzliche Einwanderung auf weniger als 27 Millionen schrumpfen. Etwas weniger dramatisch sähe es aus, wenn es gelänge, pro Jahr ca. 100.000 zusätzliche Arbeitsmigranten nach Deutschland zu locken – was angesichts der im internationalen Vergleich nach wie vor restriktiven Einwanderungspolitik gegenwärtig kaum wahrscheinlich ist. Wir brauchen also in Zukunft mehr Qualifizierung und nicht weniger.
Kennzeichen einer Akademikerschwemme?
Weiterhin wird die Ansicht geäußert, dass sich die Verdienstaussichten in akademischen Berufen zusehends verschlechterten. Eine aktuelle Studie des Instituts für Arbeit und Qualifikation (IAQ) weist aus, dass fast jeder zehnte Akademiker im Niedriglohnsektor tätig ist – ein Schicksal, das seit vielen Jahren jedoch rund ein Fünftel aller Arbeitnehmer trifft. Daher kann die Niedrigentlohnung von Akademikern schwerlich aufgrund dieser Relation als Indiz für die in den Medien vielfach hypostasierte „Akademikerschwemme“ gelten.
Das der Parteilichkeit unverdächtige Bundesamt für Statistik legt zur Frage des Sozialstatus von Akademikern eindrucksvolle Zahlen vor. Seit den 1970er Jahren, d. h. seitdem derartige Statistiken regelmäßig für das gesamte Bundesgebiet ausgewiesen werden, haben Akademiker nach wie vor ein weitaus höheres Einkommen sowie eine um rund 70 % niedrigere Arbeitslosenquote als die Gesamtheit der Arbeitnehmer, die in den letzten 40 Jahren nie über 5 % lag und sich gegenwärtig auf nur 2,4 % beläuft.
Obwohl die Zahl der Akademiker allein seit 2001 um rund 50 % gestiegen ist, verharren die Beschäftigungsquote und das Einkommenslevel auf weit überdurchschnittlichem Niveau. Ebenso zeigt der von Kollege Klein vorgeschlagene Blick nach Südeuropa mitnichten eine „Akademikerschwemme“, sondern die Zeichen einer fatalen Finanz- und Beschäftigungspolitik.
Auch in diesen Ländern haben Akademiker weitaus bessere Beschäftigungsquoten als Nicht-Akademiker. Wenngleich in Spanien jeder dritte akademisch ausgebildete Berufseinsteiger arbeitslos ist, relativieren sich diese dramatischen Zahlen vor dem Hintergrund einer seit 2009 grassierenden Jugendarbeitslosigkeit von über 50 %.
Gefährdet die OECD das deutsche Duale Ausbildungssystem und dessen internationalen Erfolg?
Das Raunen über die „Werbestrategien“ der OECD und der Bertelsmann Stiftung lässt den Leser mit der Frage zurück, warum diese Organisationen zur Akademisierung aufrufen. Will die OECD am Ende womöglich das etablierte bundesrepublikanische Duale Ausbildungssystem zerstören? Mit Blick auf das Duale System beruflicher Bildung lässt sich feststellen, dass neuerdings einzelne Akademiker, die in ihrer eigenen Biographie keine Berufsschulerfahrung vorweisen können, einen „Akademisierungswahn“ befürchten und das Duale System überschwänglich loben.
Es wird immer wieder behauptet, dass viele Länder uns um das Duale Ausbildungssystem beneiden. Aber warum wurde es seit der Inkraftsetzung des Berufsbildungsrechts im Jahre 1969(!), welches das Duale Bildungssystem in seiner heutigen Form begründete, nirgendwo jenseits deutschsprachiger Länder übernommen? Immer wieder liest man, wie viele Länder von diesem System begeistert seien.
So wird angeführt, dass Länder wie Spanien, Griechenland, Portugal, Italien, die Slowakei und Lettland ebenso wie Indien und China über Reformen im Sinne des Dualen Systems nachdenken. Jenseits weniger Pilotprojekte sowie einzelner Staaten wie Russland oder Vietnam, die punktuelle Elemente aus diesem System übertragen, erkennen die meisten Nationen aber nach wie vor nicht den von manchen deutschen Professoren im Dualen Ausbildungssystem vermuteten Stein der Weisen.
Das Duale System hat aus unserer Sicht in unserem Bildungssystem seine Berechtigung, aber es scheint keine solche Zugkraft entfaltet zu haben, so dass auch nach über 45 Jahren weltweit keine Nation dieses System übernommen hat – ganz gleich wie sehr wir hierzulande seine Vorbildfunktion in einschlägigen Artikeln anpreisen. Basis der OECD-Empfehlungen sind breite Bildungsstudien, an denen tausende Wissenschaftler zahlreicher Domänen (Fachdidaktiker, Pädagogen, Politologen, Psychologen, Soziologen, Wirtschaftswissenschaftler u.v.m.) mit dem Ziel arbeiten, Bildungsergebnisse auf Systemebene zu generieren.
Sind die Beteiligten allesamt verblendet, wie es Hans Peter Klein im Interview suggeriert? Mitnichten. Stattdessen wird der Versuch unternommen, eine empirische Basis zu bilden, um z. B. unter Rückgriff auf belastbare Zahlen, Daten und Fakten die Effizienz von Ausbildungssystemen zu vergleichen. Selbstverständlich geben diese Daten noch keinen letztgültigen Aufschluss über die Gütekriterien von Schulen oder Universitäten.
Gleichwohl kann man die Gelingensfaktoren – ausgehend von diesem Systemvergleich – gezielt in den Blick nehmen, um Qualitätsmerkmale von Ausbildungssystemen zu identifizieren, um sie übertragbar zu machen. Das Problem der Kritiker der empirischen Bildungswissenschaft ist, dass ihnen schlicht die nach wissenschaftlichen Standards der empirischen Bildungswissenschaft erhobenen Daten fehlen, die ihre Position unterstützen.
Persönliche Gespräche und Gesprächskreise, in denen sich Kritiker der empirischen Bildungswissenschaften gegenseitig bestärken – zumeist verbunden mit ausschließlich qualitativen Argumentationsfiguren – sind keine ausreichende Datenbasis, um systemische Bildungsentscheidungen im 21. Jahrhundert zu treffen. Vielmehr hat man den Eindruck, dass hier in enger beruflicher und privater Verquickung Personen aus Wissenschaft und Presse sich gegenseitig einer Realität versichern, die so in der Welt systematisch nicht vorzufinden ist.
Dies führt dann zu Begriffen wie „Akademisierungswahn“, die nicht empirisch arbeitende Philosophen und Ex-Minister wie Julian Nida-Rümelin oder Mathias Brodkorb in die Welt setzen. Zwar taucht dieser Begriff im besagten Interview nicht auf, jedoch wurde dieser an exponierter Stelle im Rahmen der von Hans Peter Klein gemeinsam mit Kollegen ausgerichteten Tagung „Bildungsexpansion oder Akademikerwahn“ an der GU (01/2015) als Faktum ohne Gegenrede dargestellt, auf der auch die genannten Ex-Minister als Bildungsexperten auftraten.
Was die OECD wirklich tut, ist schlicht darauf hinzuweisen, dass weltweit höhere Bildung in so gut wie allen Gesellschaften zu höheren Beschäftigungsquoten und steigenden Einkommen führt. Von daher kann man die Frage stellen, wer hier einem „Wahn“ aufgesessen ist.
[dt_call_to_action content_size=“small“ background=“fancy“ line=“true“ style=“1″ animation=“fadeIn“]


Die Autoren danken Prof. Dr. Tim Engartner vom Institut für Politikwissenschaften für hilfreiche Kommentare zu einer ersten Fassung dieses Beitrages.
[/dt_call_to_action]
Wie viele Akademiker sind genug?
Ein weiteres Problem der Kritiker der Akademisierung breiterer Bevölkerungsschichten ist, dass sie – im Übrigen ebenso wenig wie die Autoren dieses Beitrags – den zukünftigen Idealpunkt der Bildungsrelation zwischen Akademikern und Nicht-Akademikern kennen. Aber gibt es einen solchen überhaupt? Ohne stichhaltige Belege wird angenommen, dass der „Höhepunkt“ gesellschaftlicher und ökonomischer Entwicklungen in Abhängigkeit einer wünschenswerten Akademikerquote zu prognostizieren sei.
Aus unserer Sicht ist auf Grundlage bisheriger Daten nur sicher zu erwarten, dass Gesellschaften mit im Vergleich zu heute höheren Akademikerquoten andere Gesellschaften sein werden, vielleicht sogar – so hoffen wir – etwas aufgeklärtere Gesellschaften, wie dies bereits seit den sechziger Jahren in Deutschland geschehen ist, als sich die Akademikerrate in Relation zu heute mehr als verdreifacht hat.
Dass wir aber nun wegen einer Überakademisierung einen verhängnisvollen Zenit überschreiten, ist zumindest auf Basis existierender Daten nicht wissenschaftlich- methodisch fundiert herauszulesen. Angesichts des demographischen Wandels sind wir auf immer mehr Personen angewiesen, die vor dem Hintergrund einer sich weiter beschleunigenden technisch- sozialen Entwicklung beruflich und persönlich bestehen können.
Hierzu sind aus unserer Sicht zwei Faktoren essentiell: (1.) akademisches Methodenwissen, da uns dies erlaubt auf bisher unbekannte, aber zukünftig an uns gestellte Herausforderungen bestmöglich zu reagieren. In diesem Zusammenhang werden zusätzlich substanzielle Theoriekenntnisse verlangt, damit wir auch zukünftige Entwicklungen insbesondere in unseren beruflichen Expertisedomänen anhand von Theorien besser verstehen können und uns nicht nur auf subjektive Theorien und Plausibilitätsannahmen beschränken müssen; (2.) wird es von der Bereitschaft, lebenslang zu lernen, abhängen, ob wir auch künftig mit den gesellschaftlichen Entwicklungen mithalten können, da eine Berufsausbildung – gleich ob akademischer oder nicht-akademischer Art – meist nicht mehr ausreichen wird, ein ganzes Berufsleben lang erfolgreich zu bestehen.
So werden zukünftig in den meisten Karrieren mehr und mehr sekundäre Kompetenzen benötigt, die man in der Erstberufsausbildung nicht erwarb. Aus der pädagogisch- psychologischen Forschung weiß man, dass der beste Prädiktor für langfristig aktive Weiterbildung und lebenslang erfolgreiche Bildungsprozesse das Vorliegen einer akademischen Ausbildung ist.
Wir stimmen völlig mit der Aussage des Kollegen Klein überein, dass es nicht reicht, massenhaft Akademiker zu „produzieren“, ohne dafür auch nur annähernd genügend adäquate Arbeitsplätze bereitzustellen. Doch welche Arbeitsplätze entstehen in unseren hoch technisierten Gesellschaften? Es entstehen vor allem Arbeitsplätze für Hochqualifizierte – oder aber im Bereich prekärer Niedriglohn- Dienstleistungsaufgaben.
Von daher ist es allein eine rhetorische Frage, welche Arbeitsplätze man durch Bildungssysteme fokussieren sollte. Ob dabei die Hochqualifikation erfolgreich über akademische Abschlüsse oder einen erfolgreichen Weg durch das Duale Bildungssystem angestrebt wird, ist dabei mit Blick auf die Branche und das Tätigkeitsfeld zu bewerten.
Fragwürdig: eine »natürliche« Akademisierungsquote
Die Frage aber bleibt: Warum werden höhere Akademisierungsquoten so verteufelt? Hier können wir nur spekulieren. So wird dauerschleifenartig behauptet, dass die Hochschulen von einer immer größeren Zahl nicht studierfähiger Abiturienten „geflutet“ würden, da es „künstlich gesteigerte Abiturientenquoten von bis zu 50 % eines Jahrgangs“ (Klein im UniReport 2/2015) gäbe.
In dieser Aussage steckt neben der bedenklichen Formulierung (man erinnere sich an die Begriffe Ausländerflut, Asylantenflut etc.) die Behauptung, dass es „natürliche“ Quoten gäbe, wie viele Prozent eines Jahrgangs universitär bildbar seien. Dies ist aus unserer Sicht ausschließlich eine Definitionsfrage. Wir beobachten weltweit, dass es in den letzten 100 Jahren zu einem starken Aufwuchs der Akademikerquoten in allen technisch fortgeschrittenen Gesellschaften kommt.
Ein „natürlicher Aufwuchs“ oder eine konstante Akademisierungsquote bei 20 oder 30 % (oder gar vielleicht noch niedriger?) sind nirgends in der Welt als „Optimalpunkt“ erkennbar. Es liegt keine ernstzunehmende Studie vor, die dergleichen empirisch aufzeigt. Vielmehr müssen wir uns fragen, wie wir unsere universitäre Ausbildung den veränderten Studierendengruppen anpassen können. Sicherlich führt eine höhere Akademisierungsquote dazu, dass ein Hochschulabschluss als Regelabschluss zum Verlust des elitären Status als Akademiker führt.
Ja, es wird nichts „Einzigartiges“ mehr sein, einen Hochschulabschluss zu haben. Wahrscheinlich werden heute Menschen zu einem Hochschulabschluss gelangen, die es in früheren Generationen nicht schafften. Doch ist das ein ernstzunehmendes Problem? Vielleicht ist es auch Ausdruck dessen, dass wir heute mehr Menschen höher qualifizieren, auch wenn sie relativ nicht dieselben Niveaus erreichen wie frühere akademische Kohorten der letzten 30 Jahre, wo man nur ein Jahrgangsviertel akademisch bildete.
Davor war diese Quote noch weitaus geringer. Hat aber der rund 50%-ige Aufwuchs von Akademikerinnen allein in der letzten Dekade zu einer Verschlechterung der Akademikerqualität geführt? Bisher ist die Klage, dass es zu viele Hochqualifizierte auf dem Bewerbermarkt gäbe, zwischen Flensburg und Passau nicht geführt worden. Das Gegenteil ist der Fall.
Wenn wir nun mehr Personen eines Jahrgangs akademisch qualifizieren, wird sicher nicht jeder ein Spitzenakademiker, aber er wird wahrscheinlich individuell besser ausgebildet sein als vergleichbare Personen in den Generationen zuvor, wenn wir versuchen ihn adaptiv, d. h. ausgehend von seinen Vorkenntnissen und Potenzialen, auszubilden. Weiterhin wird postuliert, dass junge Menschen, die sich für Bildung begeistern (lassen), auch zukünftig studieren sollten.
Aber sind das wirklich die Werte, die in der Vergangenheit viele Studierenden bei der Studienwahl leiteten? Insbesondere in den zahlenmäßig großen Studiengängen (z. B. Lehramt, BWL, Jura, Medizin) ist die praxisund einkommensorientierte bzw. statusorientierte Perspektive bisher immer auch ein leitendes Motiv der Studierenden gewesen. Sicherlich ist das wohlgefällige breite Studieren in moderatem Tempo für primär Bildungsinteressierte heute nur sehr begrenzt möglich, da durch politische Steuerungsprozesse die „Regelstudienzeitabschlüsse“ einen sicher fragwürdig hohen Stellenwert haben.
Dies ist aber letztlich eine Ressourcenfrage. Wollten wir dem von Bundeskanzlerin Angela Merkel proklamierten Anspruch der „Bildungsrepublik Deutschland“ gerecht werden, müssten wir endlich mehr Geld in die Hochschulbildung stecken. Mit Finanzierungsvolumina, die seit Jahren unterhalb des OECD-Durchschnitts von ca. sechs Prozent des BIP liegen, lässt sich die Bildungsexpansion auch im „Land der Dichter und Denker“ nicht voranbringen.
So müssten wir uns deutlich intensiver um die Defizite der Studierenden mit Blick auf ihre Eingangsvoraussetzungen kümmern. Aber hier haben Novellierungen des Bildungssystems dazu geführt, dass es bei der Regelstudienzeit im Kern darum geht, möglichst viele an akademischen Bildungsprozessen teilhaben zu lassen, und zwar ohne die materielle und personelle Grundausstattung in gleichem Maße anzupassen.
Auftrag der Hochschullehrenden zielt auch auf Lehre
Zudem gilt es sich in Erinnerung zu rufen, dass Hochschulen bereits seit Jahrzehnten dauerhaft Klage über materielle Unterausstattung führten. Diese Klage gab es immer. Neu ist nun, dass man sich nun auch um mehr als das intellektuell am besten vorbereitete Viertel kümmern soll, wozu es halt nicht mehr ausreicht, ein erfolgreicher Forscher und ein traditionell Lehrender zu sein. Menschen mit sehr guten Voraussetzungen kann man erfolgreich weiterqualifizieren, auch wenn das Lehr- und Lernsetting suboptimal ist.
Viele hochbegabte Studierende, die aus Ländern mit desolaten Bildungssystemen und ärmlichsten Hochschulausstattungen zu uns kommen, beweisen dies. Wenn man jedoch Personen mit klaren Voraussetzungsdefiziten ausbilden will, müsste man sich mit der Frage auseinandersetzen, wie man Lehre in einer Art und Weise weiterentwickelt, um sie auch für Personen mit solchen Defiziten attraktiv und erfolgreich werden zu lassen.
Hierzu bedarf es niedrigerer Eingangslevels, längerer und intensiver betreuter Ausbildungsphasen sowie eines breiten pädagogischen Wissens, das sich nicht ausschließlich aus den eigenen Lehr- und Lernerfahrungen reproduziert. Das ist unbequem, arbeitsintensiv, mit wenig Reputation bedacht und nicht gerade karriereförderlich. Aber als Hochschullehrer haben wir einen gesellschaftlichen Auftrag, der nicht nur auf die Forschung, sondern eben auch – wie es unsere Berufsbezeichnung erkennen lässt – auf Lehre zielt.
Alle Untersuchungen zeigen, dass hierzulande nach wie vor der sozio-ökonomische Hintergrund ein zentraler Einflussfaktor ist, der über die (Schul-)Karriere der Kinder entscheidet – und eben nicht deren Fähigkeiten, wie dies in einer sich selbst als „Leistungsgesellschaft“ begreifenden Gesellschaft der Fall sein sollte. Wenn man, wie wir beide, als jeweils Erste in der Familie das Abitur abgelegt hat, weiß man, wie es sich anfühlt, wenn die Verwandten fragen, ob man nicht lieber etwas Sinnvolles machen wolle (eben einen konkreten Beruf erlernen).
In dieses Horn sollten nun nicht ausgerechnet wir Professorinnen und Professoren auch noch stoßen, sondern alles in unserer Macht Stehende tun, dass mehr – und nicht weniger(!) – Menschen die Qualifikation für ein Hochschulstudium erwerben und dieses dann erfolgreich abschließen. Diese Hochschulen können durchaus Fachhochschulen sein, die in sehr vielen Fällen eine exzellente Ausbildung anbieten.
Wie könnte das »Duale System von morgen« aussehen?
In anderen Ländern, in denen wir arbeiteten, haben wir erfahren dürfen, dass die gezielte Weiterqualifikation auch an Hochschulen stattfindet. In der Schweiz ist das „Lebenslange Lernen“ an Hochschulen seit Jahren ein etablierter Weg im Rahmen der eigenen berufsbegleitenden Qualifikation, und zwar von Akademikern ebenso wie von Nicht-Akademikern. Hier sind nicht-konsekutive Weiterbildungs- Mastergrade etabliert, die in modularer Weise erworben werden – zum Teil vom Arbeitgeber gefördert – berufsbegleitend oder aber in Intervallen, in denen Phasen beruflicher Tätigkeit mit Weiterbildungsphasen wechseln.
Auch so kann eine Akademisierung breiterer Bevölkerungsschichten in einem innovativen Dualen System aussehen. Und in England funktioniert das Bachelor-/Mastersystem anders als in Deutschland und unserer Meinung nach auch sinnvoller. Die Studierenden verlassen die Universitäten in der Regel nach drei Jahren mit einem Bachelorabschluss, um in vielen Fällen erst einmal Praxiserfahrung zu sammeln und nach einigen Jahren wieder an die Hochschule zurück zu kehren, z. B. in Teilzeitmasterstudiengängen oder aber in Gestalt von Formaten (Stichwort: Distance Learning), die wir uns in Deutschland gerade einmal an einer einzigen FernUniversität vorstellen können.
Wir hingegen haben hierzulande zwar das alte Diplomsystem in einen BA- und einen MATeil zerlegt, aber in den Köpfen von Lehrenden und Studierenden ist es nach wie vor die Regel, beide Teile nahtlos und ohne Unterbrechung oder Fachwechsel „durchzustudieren“. Hier geben wir dem Kollegen Klein durchaus recht: Nicht jeder muss die höchste wissenschaftliche Qualifikationsstufe erreichen, nicht jeder muss Forscher werden. Aber bestmögliche Bildung und Ausbildung brauchen wir für alle, und zwar deutlich mehr als bislang!
[dt_call_to_action content_size=“small“ background=“fancy“ line=“true“ style=“1″ animation=“fadeIn“]
Zum Weiterlesen: Interview mit Hans Peter Klein im UniReport 2/2015:
www.uni-frankfurt.de/54939957/Uni
[/dt_call_to_action]