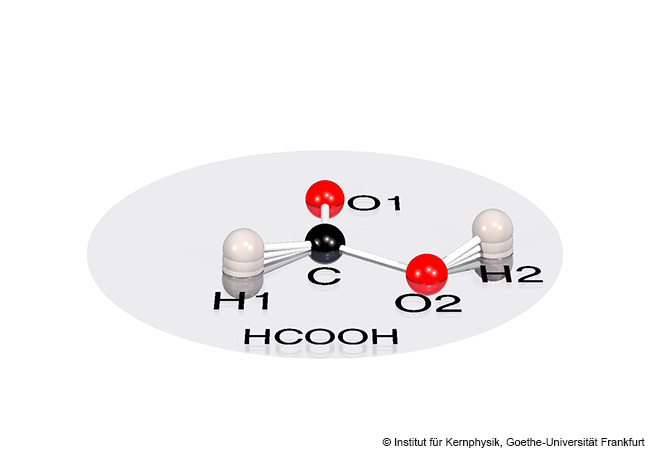Erziehungswissenschaftler Jochen Kade über seine jüngst erschienene Langzeitstudie
UniReport: Herr Prof. Kade, Ihr Buch handelt von Selbstbildung zwischen 1984 und 2009. Was ist eigentlich Selbstbildung?
Jochen Kade: Bei Bildung denkt man ja meist an Unterricht. Das ist aber nur eine Form, in der Bildungsprozesse in einer Gesellschaft ablaufen. Vieles geschieht im Verborgenen: Aktivitäten des Einzelnen, wie zum Beispiel Bücher und Zeitungen lesen, alle Arten von (Massen-)Medien zu rezipieren. Individuelle Selbstbildung geschieht in hohem Maße plural, thematisch offen, ja zerstreut, diffus.
Geschieht diese Form des Lernens bewusst?
Nicht unbedingt. Bei der Zeitungslektüre geht es ja nicht darum, sich zu bilden. Man will sich informieren oder unterhalten. Und doch ist damit ein Bildungsprozess verbunden, eine Selbstformung. Auch Erfahrungen spielen eine Rolle.
Wenn sich die Menschen dessen gar nicht bewusst sind, wie haben Sie sie danach gefragt?
Wir haben offene Interviews mit Erwachsenen geführt, die eine gewisse Affinität zu Bildungsprozessen haben. Es wurde über Erfahrungen allgemeiner Art gesprochen. Die Interviews wurden dann im Blick auf die Bildungserfahrungen analysiert, auf die die biographischen Erfahrungen verweisen.
Das besondere Ihrer Studie ist ja die zeitliche Dimension.
Wir haben Erwachsene aus drei Generationen im Abstand von 25 Jahren zweimal interviewt. Im Mittelpunkt stand die Generation der in den 1940er Jahren Geborenen. Es wurden auch Gespräche mit der vorangegangenen und mit der Baby-Boomer-Generation geführt. 1984 wurden 85 Personen interviewt, 50 davon wurden 2009 noch einmal befragt. Gerade bei den Frauen zeigten sich in den bildungsbiographischen Momentaufnahmen große Unterschiede.
Wo liegt der größte Unterschied?
Eine Person, die in der NS-Zeit aufwächst, beginnt nach der Schule mit einer Berufsausbildung. Als ein Kind kommt, geht sie aus dem Beruf, weil das erwartet wird. Im Kontrast dazu die Nachkriegsgeneration, die sich ihre Freiheit erkämpfen wollte, was nicht immer gelang. Und dann die Baby-Boomer, für die ein eigener Beruf selbstverständlich war.
Welche Rolle spielt die Emanzipationsbewegung?
Die Gesprächspartnerin, die 1917 geboren wurde, hatte vier Kinder. Als sie 60 war, waren die Kinder aus dem Haus, der Mann tot. Unter dem Einfluss der Emanzipationsbewegung versuchte sie, ein neues, emanzipiertes Leben zu führen. Nicht in Hinblick auf einen Beruf, eher durch Ehrenamt und Erwachsenenbildung.
Emanzipation im Sinne von Selbstbestimmung?
Wenn das alte Leben wegbricht, denkt man darüber nach: Wer bin ich? Wie will ich leben? Unter dem Aspekt von Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung ergeben sich ganz neue Fragen.
Sind Selbstbild und Selbstbildung für Sie deckungsgleich?
Selbstbildung bezieht sich auch darauf, wie ich mein Leben erzähle und ihm so eine öffentliche Gestalt gebe. Es ist interessant, dass sich die biographischen Erzählungen nach 25 Jahren oft radikal verändert haben.
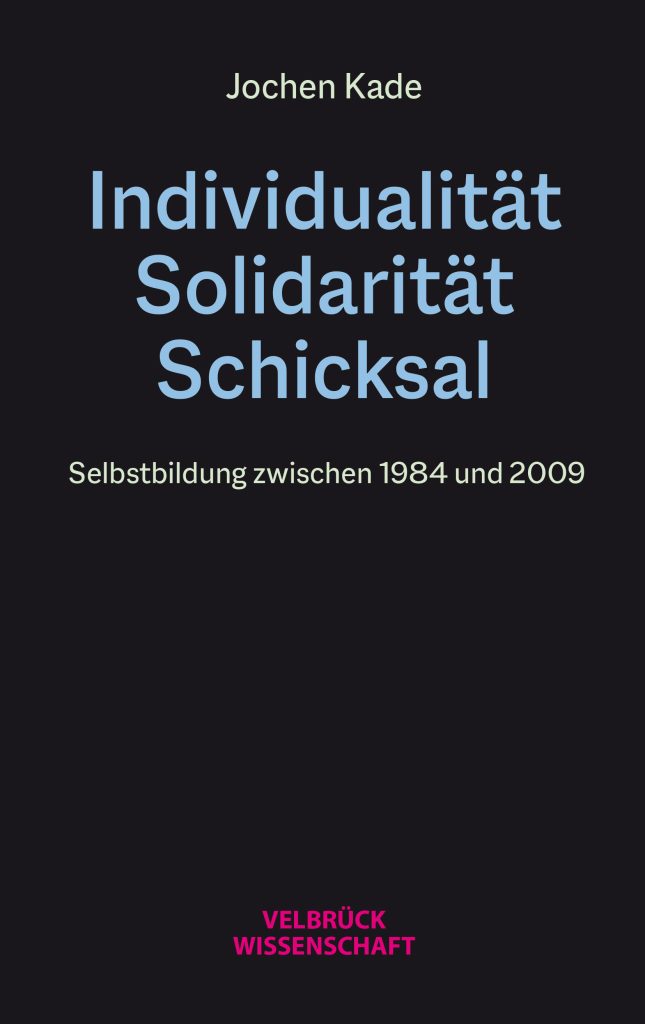
Jochen Kade
Individualität, Solidarität, Schicksal. Selbstbildung zwischen 1984 und 2009
Velbrück Wissenschaft 2023, Weilerswist-Metternich
Worin bestehen diese Veränderungen?
1984 erzählt eine Person aus der Nachkriegsgeneration etwa, wie sie sich von ihrer Herkunftsfamilie absetzt, um selbstbestimmt zu leben. 2009 erzählt dieselbe Person von ihren Kindheitserfahrungen ganz anders – sie thematisiert sie als Lebensressource. Bei der Vorkriegsgeneration geht es 1984 um nachgeholte emanzipatorische Erfahrungen außerhalb der Berufstätigkeit. 25 Jahre später, mit über 90 Jahren, geht es darum, nicht als unmündig aus der Gesellschaft herauszufallen. Die Baby-Boomer formulieren 1984 selbstbewusst berufliche Ansprüche. 25 Jahre später relativieren sie das eigene, selbstbezogene Leben sozial; zum Beispiel durch ein Engagement für die Karriere jüngerer Frauen.
Welche Schlüsse ziehen Sie aus Ihrer Studie?
Es gibt eine Vielfalt individueller Bildungsprozesse, und sie verändern sich generationell, historisch und altersmäßig. In den 70er und 80er Jahren ist Individualität ein starker Bezugspunkt, in den 90er Jahren verschiebt sich die Bildungsorientierung hin zu Solidarität mit anderen. Diese wird nicht mehr als Grenze von Individualität erfahren, sondern eher als Bedingung ihrer Entfaltung. In den Nullerjahren kommt die Erfahrung von Unverfügbarkeit ins Spiel, eine Art Schicksalsorientierung. Die Corona-Pandemie gehört dazu, der Ukrainekrieg, aber auch Erfahrungen beruflicher Enttäuschung und, zunehmend, von Erkrankungen.
Und was heißt das für die Bildungstheorie?
Unverfügbarkeiten und Solidarität sollten in einem zeitgemäßen Bildungsverständnis berücksichtigt werden; auch wenn individuelle Freiheitserwartungen weiter der Fluchtpunkt bleiben. Ja, wir brauchen eine Bildungstheorie, die Individualität, Solidarität und Schicksal in den Gesamtkomplex von Bildungsund Selbstbildungserfahrungen einbezieht.
Fragen: Anke Sauter
Jochen Kade ist Professor em. für Erziehungswissenschaft an der Goethe-Universität.