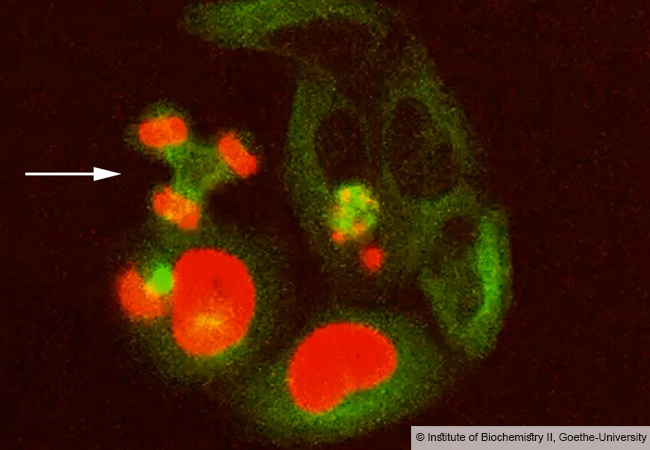Mit dem neuen Jahr steht ein Wechsel an der Uni-Spitze an. Universitätspräsidentin Birgitta Wolff übergibt nach sechs Jahren das Amt an Enrico Schleiff, der von 2012 bis 2018 bereits als Vizepräsident für die Goethe-Universität aktiv war. Im Austausch mit dem Goethe Spektrum und dem UniReport spricht Wolff über das besondere „Corona-Jahr“ 2020 und die aktuelle Position der Uni.
UniReport: Frau Prof. Wolff, seit März haben Sie eine Uni im Ausnahmezustand gesteuert. Was haben Sie über die Goethe-Universität in Corona-Zeiten noch einmal neu gelernt?
Prof. Dr. Birgitta Wolff: Krisensituationen verursachen Stress. Sie haben das Potenzial, in vielen Menschen Gutes, geradezu Erstaunliches zutage zu fördern, während sich andere verzweifelt zurückziehen. An der Goethe-Universität fiel extrem auf, wie viel Energie und Engagement viele auf einmal entwickelt haben, um den Unibetrieb trotz Corona am Laufen zu halten und den Studierenden ein Studium mit 30 ECTS zu ermöglichen – genau das war uns wichtig für die Studierenden! Dazu kam, dass die Stimmung, gerade auch im Großen Krisenstab, extrem konstruktiv und ein starkes Wir-Gefühl zu spüren war. Dieses Signal: Wir machen das hier jetzt zusammen, und wir machen das Beste draus, fand sich auch in mehreren gemeinsamen Erklärungen, einer von Senat und Präsidium, und bei einer zweiten war zudem noch die Dekan*innenrunde dabei. Aber: Diese Zeit hat uns alle sehr viel Kraft gekostet. Und deswegen sind wir uns auch einig, dass dies kein Dauerzustand sein kann.
Im Januar bekommt die Goethe-Universität mit Prof. Enrico Schleiff einen neuen Präsidenten. Was bedeutet das für die Kontinuität der Strategieprojekte?
Das ist eine gute Frage. Sowohl der Hochschulentwicklungsplan (HEP) als auch das Forschungsprofil sind nicht „Projekte der Präsidentin“, sondern sie wurden mit vielen verschiedenen Beteiligten aus der ganzen Universität gemeinsam erarbeitet. Aber es versteht sich, dass wir nicht kurz vor der Staffelstabübergabe diese Pakete fest zuknoten, sondern dass Enrico Schleiff die Freiheit haben muss, eigene Akzente zu setzen. Bei solchen Übergängen gilt es immer, eine Balance zu finden zwischen einerseits gewolltem Wandel und andererseits Kontinuität. Dass sich aber ganz grundsätzlich noch etwas ändern wird, würde ich zum jetzigen Zeitpunkt eher ausschließen. Zumal Enrico Schleiff seit einigen Monaten schon aktiv im Präsidium und davor in einschlägigen Gremien mitgearbeitet hat: Als Präsidiumsbeauftragter für Forschung und Infrastruktur nimmt er Aufgaben wahr, die zuvor in die Zuständigkeit von Vizepräsidentin Simone Fulda fielen. Mir ist ein guter Übergang sehr wichtig. Ich binde Herrn Schleiff darum auch schon länger in Themen und Abläufe ein, die direkt in meiner Zuständigkeit liegen; es gibt noch mal einen Unterschied zwischen dem abgegrenzten Ressort eines Vizepräsidenten und der Gesamtverantwortung einer Präsidentin. Und Enrico Schleiff bringt seine Vorstellungen auch schon ein. Insofern denke ich, dass es vor allem einen neuen Schwung mit einigen neuen Impulsen geben wird.
Wenn Sie zurückblicken, gibt es irgendetwas, das Ihnen hier besonders erwähnenswert erscheint?
Es gab einige besondere Momente. Aber einer, der zu deutlich neuen Weichenstellungen geführt hat, war der „Exzellenzflopp“: Dieser Schock im September 2017, als herauskam, dass wir nur mit einem Exzellenzcluster in der Hauptbegutachtung sein würden, führte dazu, dass viele zurecht gefragt haben, was an unserer bisherigen Art großformatiger Verbundforschung vielleicht doch nicht gepasst hat. Danach waren viele bereit, die bisherige Organisation und Ausrichtung dieser Forschungsverbünde noch einmal grundlegend zu hinterfragen. Sowohl intern als auch mit externer Beratungsunterstützung haben wir alles gründlichst aufgearbeitet. Dabei konnten wir ziemlich genau feststellen, wo es Schwachstellen im Entwicklungsprozess gegeben hatte: Was gefehlt hatte, war eine konsequente Trennung von Beratung der Forschenden, Begutachtung von Proposals und auch der Entscheidung darüber, was wir machen und fördern oder eben nicht. In der Konsequenz haben wir völlig neue Strukturen geschaffen und eben das Forschungsprofil zur Orientierung. Wir setzen viel stärker auf Benchmarking, auf externe Begutachtung. Und wir setzen durch, dass diese Empfehlungen dann auch umgesetzt werden: Wenn es plausible Signale aus der Wissenschaftscommunity gibt, dass wir in unserer Forschung neue Akzente setzen müssen, dann müssen wir das sehr ernst nehmen. Und genau das passiert jetzt.
Auch das Land Hessen bringt sich jetzt stärker ein, um seine Universitäten zu unterstützen für künftige Exzellenzwettbewerbe. Welche Vorbereitungen laufen dazu jetzt schon?
Zur Vorbereitung auf eine nächste Exzellenzrunde hat das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst eine Förderlinie „Clusterprojekte“ gestartet, für die wir im November vier Forschungsverbund-Kandidaten der Goethe-Universität vorgestellt haben. Bisher war das Feedback sehr ermutigend; die offizielle Rückmeldung aus dem HMWK-Prozess wird aber erst für Januar erwartet. Außerdem hat das HMWK am Rande des Hessischen Hochschulpaktes mit den hessischen Unis eine „Strategieertüchtigungslinie“ entwickelt.
Das Land verfolgt dabei eine mehrgleisige Strategie. Einerseits will man Hessen auf die Exzellenzlandkarte in diesem Bundeswettbewerb bringen. Andererseits gibt es in der hessischen Wissenschaftspolitik immer auch eine Politik für die Fläche. Das heißt, so ein klares Bekenntnis wie beispielsweise in Bayern zur komprimierten Exzellenz, die dann ergänzt wird durch Exzellenz in den Regionen, gibt es bei uns nicht. Deswegen muss unsere Strategie auch anders sein als beispielsweise in München. Und auch deshalb vernetzen wir uns stark mit den anderen hessischen Universitäten. Vernetzung ist ja nicht Selbstzweck, sondern dient unseren wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Zielen.
Apropos Vernetzung: Die Interessen der Universität haben Sie auch über Ihre Mandate in wissenschaftspolitischen Organisationen vertreten; mit Ihnen hat die Goethe-Universität aus den Kooperationen mit den Hochschulen in Frankfurt und der Rhein-Main-Region engere Allianzen gemacht. Was hat sich für die Universität dadurch verändert?
Die Veränderungen passieren auf mehreren Ebenen. Auf der einen Seite werden durch gemeinsame verstärkte Forschungskooperationen mit den außeruniversitären Forschungseinrichtungen wie den Leibniz- und Max-Planck-Instituten neue Forschungsfragen gestellt und gemeinsam beforscht. Durch unsere lokale und regionale Vernetzung sind wir auch mit der FRA-UAS und den anderen Universitäten, insbesondere den Rhein-Main-Universitäten, gut verbunden, profitieren bei gemeinsamen Forschungsprojekten und Studienangeboten, aber auch durch gemeinsames Lernen beim Austausch auf der Organisationsebene. Oft sind auch unsere Forderungen an die Politik deckungsgleich, und vereint werden wir einfach besser gehört als als einzelne Universität. Als „Frankfurter Wissenschaftsrunde“ haben wir zum Beispiel gemeinsame „Wahlprüfsteine“ vor den Kommunalwahlen formuliert und wiederholt Dezernenten der Stadt Frankfurt zu Gast gehabt. Auch die KHU, die Konferenz Hessischer Universitätspräsidien, war gemeinsam wissenschaftspolitisch erfolgreich.
In verschiedenen Netzwerken konnten wir etliche Diskurse zur Forschungslandschaft aktiv mit beeinflussen. Ich war ja bis September KHU-Sprecherin, die für die fünf hessischen Universitäten spricht, bis Dezember im Präsidium der Hochschulrektorenkonferenz und bin weiterhin in diversen anderen Beratungsgremien in Berlin und darüber hinaus. Das hat sich ganz direkt ausgezahlt für die Uni und hat zum Beispiel mit dazu geführt, dass wir beim Hochschulpakt viel informierter verhandelt und letztlich ein viel besseres Ergebnis erzielt haben. Unsere Grundfinanzierung haben wir so deutlich verbessern können. Das war ein großes politisches Ziel.
Ausgezahlt hat sich auch die aktive Mitgliedschaft im Verbund German U 15. Wir sind uns als große, forschungsorientierte Universitäten sehr ähnlich, und es hat einen intensiven und zunehmend vertrauensvollen Austausch gegeben. Manchmal sind die U 15 etwas beweglicher, schneller als die Hochschulrektorenkonferenz und können sich gegenüber der Berliner Politik klarer artikulieren. Daher ergänzt sich das Engagement in den verschiedenen Netzwerken sehr gut. Ich bin überzeugt, dass die Kombination von RMU, KHU, U15 und HRK-Präsidium uns sehr geholfen hat.
Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass wir als Hochschulen gleichzeitig in Konkurrenz um Fördermittel stehen. Das steht dann teilweise auch in einem Spannungsverhältnis zu guten Kooperationsprojekten – weil Anreizstrukturen im System teilweise weiterhin so sind, dass sich mitunter immer noch eher das Gegeneinander als das Miteinander zu lohnen scheint.
Noch einmal intensiver geworden ist auch die Vernetzung mit Frankfurter Traditionsinstitutionen wie dem Fritz Bauer Institut, dem Sigmund-Freud-Institut, dem ISOE, dem IfS oder dem Jüdischen Museum. Was bedeuten diese Partnerschaften ganz praktisch für die Entwicklung der Goethe-Universität?
Wir haben auch diese Kooperationen tatsächlich noch einmal auf eine andere Ebene gehoben. Schon kurz nach meinem Amtsantritt hatten wir einen Plan für eine gemeinsame Berufung mit dem Fritz Bauer Institut – diese „Holocaust-Professur“ – die erste in Deutschland – konnten wir mit Sybille Steinbacher bestens besetzen. Jetzt führen wir gerade mit dem ISOE eine gemeinsame Berufung durch, um auch dort die akademische Leitung ganz eng mit der Uni zu verbinden; das Gleiche läuft gerade mit dem Institut für Sozialforschung. Auch für das Sigmund-Freud-Institut empfiehlt der Wissenschaftsrat, von einer halben gemeinsamen Berufung auf eine ganze Professur hochzuskalieren. Stärker vernetzt sind wir auch mit anderen forschenden Partnern in Frankfurt. Beispielsweise ist die Leiterin des Jüdischen Museums auch Honorarprofessorin bei uns; die Leiterin der HSFK, Nicole Deitelhoff, ist als „Teilzeit-Professorin“ der Goethe-Universität Mitsprecherin beim Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Mit SAFE haben wir im House of Finance ein neues Leibniz-Institut sogar direkt auf dem Campus. Auch die strategische Verbindung mit dem DIPF ist viel enger geworden, beispielsweise beim studium digitale. Diese engen Allianzen halte ich für ganz wichtige Entwicklungen. Sie ermöglichen es uns, dass wir trotz des Finanzierungswettbewerbs aus dem unproduktiven Konkurrieren zwischen den unterschiedlichen Forschungseinrichtungen herauskommen. Und sie sind auch eine ganz besondere Chance für ein Alleinstellungsmerkmal unserer Uni, eben eine ganz Frankfurt-spezifische Allianz.
Die „Erfindung“ des Museumsufers hat vor einigen Jahrzehnten die Wahrnehmung Frankfurts sehr zum Positiven verändert. Ähnliches schwebt Ihnen mit der Vision einer Campusmeile vor. Worum geht es dabei?
Die Grundidee ist, im ersten Schritt stärker zu vermitteln, dass Frankfurt nicht nur eine Stadt der Banker und Logistiker, sondern auch eine Wissens- und Wissenschaftsstadt ist. Diese Dichte an Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und weiteren, auch forschenden, Institutionen wie dem Zoo oder dem Feien Deutschen Hochstift, sucht ihresgleichen. Diese andere Seite Frankfurts wollen wir als Marke sichtbar und erlebbar machen und dadurch ein noch interessanterer Partner für Kooperationen weit über Rhein-Main hinaus sein. Die Campusmeile denken wir entlang des nördlichen Alleenrings, mit der Goethe-Universität, der FRA-UAS, der Frankfurt School of Finance and Management und der Deutschen Nationalbibliothek. Ein Ankerpunkt wird dabei die künftige Universitätsbibliothek sein. Darüber hinaus wird gegenüber der Nationalbibliothek ein gemeinsames Wissenszentrum – der „Campus-V“, wobei V für Verantwortung steht – zum gemeinsamen Arbeiten an Themen wie Social Entrepreneurship, angewandte Künstliche Intelligenz und Wissenstransfer entstehen.
Im Rahmen des Hightech-Forums der Bundesregierung, dem ich angehöre, haben wir bei einem „Regionaldialog“ außerdem die Idee für ein Modellprojekt im Raum Rhein-Main formuliert. Die Überlegung ist, mit einer Art Trainee-Programm prototypische Karriereentwicklungspfade zu gestalten, die einrichtungsübergreifend Laufbahnen ermöglichen. Wenn unsere Promovierenden und Postdocs unterschiedliche Wissensorganisationen von innen kennenlernen, können sie treffsicherer entscheiden, was am besten zu ihnen passt. Auch vor dem Hintergrund, dass die konventionelle Universitätskarriere ja nie ohne Ortswechsel funktioniert – das ist zunehmend ein Problem, da heute ja meistens beide Partner in einer Beziehung berufstätig sind. Wenn wir Wissenschaftskarrieren flexibler denken, ergeben sich auch mehr Möglichkeiten für eine Wissenschaftslaufbahn am gleichen Standort.
In den letzten Jahren wurde viel über Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit in der Gesellschaft und an der Hochschule debattiert. Wie sehen Sie persönlich die Diskussion, welche Position sollte die Universität einnehmen?
Für mich war und ist immer wichtig, die Universität als Ort des wissenschaftlich geleiteten Diskurses in der Gesellschaft zu positionieren. Eine Universität ist kein Stammtisch. Der hat auch seinen Platz, aber nicht auf dem Campus. Wenn man eingeladen wird, Teil eines wissenschaftlichen Diskurses zu sein, darf man alles sagen, aber auf der Basis von Fakten und Hypothesen, die eben auch sich selbst infrage stellen lassen – das ist Wissenschaft. Wir haben mit der Bürgeruniversität ein Veranstaltungsformat, das offen ist für aktuelle und auch kontroverse Themen. Beispielsweise in der Veranstaltung „Diskurskultur im Zwielicht – Wie viel Meinungsfreiheit verträgt die Uni?“ habe ich mit Wissenschaftler*innen und Studierendenvertreter*innen offen und konstruktiv diskutiert; wir haben insgesamt Konsens darin erzielt, dass wir diskursiv, d. h. mit sachlichen Argumenten über kontroverse Themen streiten wollen; Einschüchterungen und Drohgebärden haben an einer Universität definitiv nichts zu suchen.
Am 10. Dezember wurde auch an der Goethe-Universität der Diversity-Tag 2020 begangen: Wo steht die Goethe-Universität heute, wenn es um Diversity und Gleichstellung geht?
Die Wertschätzung von Offenheit und Vielfalt findet sich im Leitbild der Goethe-Universität; wer an der Goethe-Universität studiert, forscht, arbeitet, sollte ungeachtet seines Geschlechts, seiner Herkunft und Neigungen, seiner Hautfarbe und Besonderheiten seine Potenziale entfalten und am respektvollen Miteinander einer modernen Institution partizipieren können. Wir haben heute viel mehr Heterogenität in der Studierendenschaft. Wenn Sie sich die Entwicklung unseres Gleichstellungsbüros anschauen, sehen Sie alleine am Zuwachs der Stellen dort, wie viel gewichtiger dieses Thema auch für uns geworden ist. Wir haben gerade in einer der letzten Präsidiumssitzungen auch die Verstetigung der Antidiskriminierungsstelle beschlossen. Wir haben die Support-Strukturen für die Studienanfänger*innen weiterentwickelt, ausgebaut, wir haben aber auch die psychosoziale Beratung sowohl für die Studierenden aber auch für Mitarbeitende deutlich aufgestockt. Ich glaube, damit spiegeln wir Trends in der Gesellschaft insgesamt. Ein Anliegen, das ich seit vielen, vielen Jahren verfolge ist, die Zahl der Frauen auf Professuren zu erhöhen. Ich komme ja selbst noch aus einer Generation, wo ich zunächst als Frau immer die erste und einzige war, egal, ob es damals der Rat der BWL-Fakultät an der LMU in München oder die Wirtschaftsfakultät der Uni Magdeburg war. Das hat sich Gott sei Dank inzwischen alles doch sehr stark normalisiert. Wir haben in diesem und im letzten Jahr so viel Frauen berufen, dass wir inzwischen bei drei Fachbereichen die Parität erreicht haben könnten. Ich bin gespannt auf die Jahresauswertung 2020.
Nach sechs Jahren als Präsidentin gehen Sie jetzt wieder aktiv in die Wissenschaft. Wozu werden Sie forschen?
Zum Start werde ich über zwei Semester ein Forschungs-Sabbatical einlegen, um zu Themen der Digitalisierung, zu „New Work“, zu neuen Organisationsformen zu forschen. Dabei kann ich an meine frühere wissenschaftliche Arbeit nahtlos wieder anschließen: Vieles von dem, was ich damals gemacht habe und was damals für manche noch eher Science Fiction war, ist heute wieder hochaktuell. Beim Thema „Arbeit in der digitalen Welt“ gibt es natürlich auch viele Gestaltungsaufgaben, bei denen ich mich vielleicht einbringen kann. Ich stehe zum Beispiel mit der Landesregierung im Gespräch für eine entsprechende Initiative aus dem Koalitionsvertrag. Für die Goethe-Universität werde ich natürlich auch weiterhin tun, was immer ich kann – sofern gewünscht. Dabei hilft, dass etliche meiner aktuellen Mandate nicht an das Präsidentschaftsamt gekoppelt sind, wie etwa der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitz in der Bundesagentur für Sprunginnovationen oder die Mitgliedschaft im HighTech Forum oder in Jurys beim BMBF.
Das Amt der Präsidentin lässt sich nicht in einem Acht-Stunden-Tag unterbringen. Was haben Sie während der Präsidentschaft vermisst, das Sie jetzt wieder machen möchten?
Erstens: forschen; in Ruhe lesen, denken, wieder etwas schreiben. Und ehrlich gesagt freue ich mich auch darauf, dass ich nicht jeden Tag mit einem Zwölf- oder 14-Stunden-Arbeitstag rechnen muss. Ich freue mich darauf, wieder mehr Zeit mit meiner Familie und unseren Tieren, insbesondere den Pferden, verbringen zu können; das ist eine andere Art von Lebensqualität. Lebensqualität ist es natürlich auch, sich für so eine tolle Uni einsetzen zu können, und das ist auch unglaublich befriedigend. Aber ich kann Ihnen sagen: Es ist mitunter auch wirklich sehr, sehr anstrengend. Wissenschaftliches Arbeiten entsteht auch in Freiräumen. Auf die Balance zu forschen, und auch mich noch ein wenig wissenspolitisch weiter auszutauschen, freue mich sehr. Und natürlich dann auch wieder sehr auf den Austausch mit den Studierenden in der Lehre!
Interview: Imke Folkerts und Dirk Frank