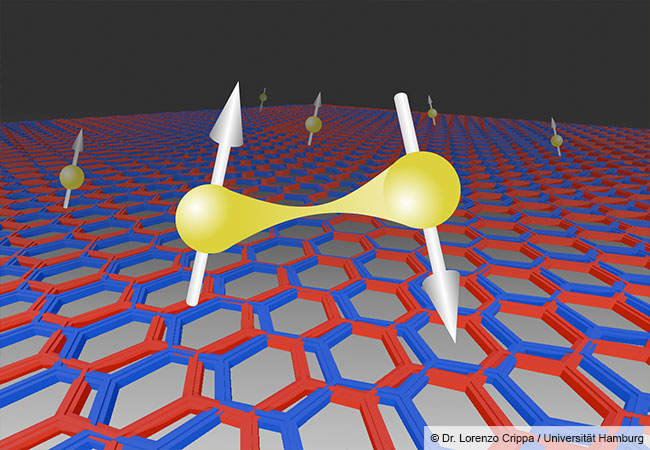Ich möchte so gern nach Hause gehen / Die Heimat möchte ich wieder sehn / Ich find allein nicht meinen Schritt / Wer hat mich lieb und nimmt mich mit / Ich bin so verlassen / Und hör kein liebes Wort / So fremd sind die Gassen / Warum kann ich nicht fort?“
Toxi (BRD, 1952, Robert A. Stemmle)
In James Gregory Atkinsons Film 6 Friedberg-Chicago (2021) werden die Bewegungen und Gruppenformationen von 17 jungen Schwarzen Protagonisten in den Ray Barracks – einer ehemaligen Kaserne der US-Armee in Friedberg – von einer Neuinterpretation des Toxi-Liedes durch die queere Harfenistin Ahya Simones begleitet. Die Väter der jungen Männer waren, ebenso wie Atkinsons eigener Vater, als afroamerikanische US-Soldaten in Deutschland stationiert. Atkinsons emotionaler Film findet ästhetische Bilder dafür, wie Schwarze deutsche und männliche Subjekte durch die sie umgebende Kultur geformt und ihnen bestimmte Rollen zugedacht werden. Die stillstehenden, sich bewegenden und tanzenden Körper inkorporieren solche Zuschreibungen und entziehen sich ihnen zugleich. 6 Friedberg-Chicago ist Teil eines ständig wachsenden nichtlinearen Archivs aus Texten, Bildern, Objekten und Zeitzeugenberichten, das sich mit der Rezeption Schwarzer Soldaten in Deutschland sowie deren in Deutschland geborenen Kindern befasst. James Gregory Atkinson verbindet in seinen recherchebasierten Projekten Autobiografisches mit politischer Geschichte und reagiert auf die extreme Unvollständigkeit offizieller Archive Schwarzer Menschen in Deutschland. Dabei greift Atkinson auf transnationale queere und Schwarze Narrative zurück, modifiziert diese und bringt sie in einen Dialog mit der Gegenwart.
Im Seminar der Studiengalerie 1.357 diskutieren James Gregory Atkinson und Prof.‘in Antje Krause-Wahl Schwarze und queere Perspektiven auf deutsche Geschichte, Politik und Kultur mit Studierenden und internationalen Gästen.
Der Titel des Seminars und der begleitenden Gesprächsreihe „Deutsche sind Schwarz! Faschisten können keine Deutschen sein“ nimmt auf Christel Priemers Dokumentarfilm „Deutsche sind weiß- N**** können keine Deutschen sein!“ (1986) Bezug. Er wurde in einem rechtsradikalen Drohbrief verwendet, der an die Schwarzen Interviewpartner*innen der Produktion Priemers adressiert war. Diese legten u.a. in regelmäßigen regionalen Treffen in Wiesbaden zu dieser Zeit die Grundbausteine der heutigen Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland (ISD e.V.).
Die 2010 gegründete Studiengalerie 1.357 ist Teil des Forschungszentrums für Historische Geisteswissenschaften. An vier Terminen im Jahr zeigt sie international etablierte künstlerische Positionen (http://studiengalerie.uni-frankfurt.de/home.html). In begleitenden disziplinübergreifenden Seminaren wird dadurch ein Raum für Debatten eröffnet. Recherchebasierte künstlerische Praktiken wie diejenige Atkinsons, die inmitten aktueller Diskussionen um das Öffnen und Umschreiben von Archiven stehen, geben auch für die universitäre Forschung zentrale Impulse für notwendige Neuperspektivierungen.
James Gregory Atkinson (*1981 in Bad Nauheim) studierte bei Douglas Gordon an der Städelschule, Frankfurt und erhielt Stipendien und Künstlerresidenzen in der Villa Aurora, Los Angeles (2016), der Jan Van Eyck Akademie, Maastricht (2017) sowie ein Atelierstipendium der Hessischen Kulturstiftung in New York (2018).
Antje Krause-Wahl ist seit 2021 Heisenberg-Professorin für Gegenwartskunstgeschichte am Kunstgeschichtlichen Institut.
Termine:
Ausstellung Studiengalerie 1.357 (der Name der Studiengalerie greift die Raumnummer im I.G. Farben-Gebäude auf)
11. Januar – 02. Februar 2023
Eröffnung: 11. Januar, 20 Uhr
Gespräche:
10.01.2023, 18-20 UHR, Eisenhower Saal (IG 1.314)
James Gregory Atkinson im Gespräch mit: Priscilla Dione Layne* (University of North Carolina at Chapel Hill / NC, US)
„Queer, schwarz, deutsch.“
Die Veranstaltung findet über Zoom statt.
18-20 UHR, Eisenhower Saal (IG 1.314)
Julia Grosse (UDK, CONTEMPORARY AND (C&), BERLIN, DE)
„Kunstwelten“
Antje Krause-Wahl im Gespräch mit James Gregory Atkinson
Antje Krause-Wahl: Im Rahmen der Studiengalerie hast Du unter anderem Maria Höhn oder Eleonore Wiedenroth-Coulibaly eingeladen, um mit ihnen über afrodeutsche Geschichte und Identität zu sprechen. Warum ist es für Dich wichtig, dass die Veranstaltung im Eisenhower-Saal stattfindet?
James Gregory Atkinson: Der Eisenhower Saal in dem vom U.S. Militär besetzten I.G. Farben-Gebäude trug einst den Namen “The Pentagon of Europe”. Von diesem Büro aus beaufsichtige Eisenhower auch die Organisation und den Einsatz der US-Truppen in Deutschland. In ihm verhandelten hochrangige Mitglieder der US-Streitkräfte und Regierung mit Persönlichkeiten alliierter Befreiungsmächte über das Schicksal Deutschlands nach 1945. Ein Archiv stellt nicht nur unbedingt eine Institution oder ein Gebäude/eine Architektur dar, in dem/der schriftliche Dokumente aufbewahrt werden. Vielmehr lässt sich dieser Begriff auch auf Körper, orale und performative Traditionen erweitern. Es war mir wichtig, genau unsere Körper in diesen historischen Raum (einzu)bringen, um die autoritäre Form der Wissensproduktion an Forschungs- und Bildungsinstitutionen wie Universitäten zu hinterfragen, die Binarität des so genannten ‚Andersseins‘ dekonstruieren, die durch diskursive Entfremdung und Dominanz geprägt ist. Welche Form der Autorität soll eigentlich weitergegeben werden? Welches Wissen soll weitergegeben werden? Die Reaktivierung des Saals ist für mich Zeichen auf persönlicher, gesellschaftlicher und politischer Ebene. In ihr sehe ich die Möglichkeit, einen vergessenen Teil afroamerikanisch/afrodeutscher Geschichte im universitären Kontext zu beleuchten und sich mit den Erfahrungen Schwarzer Soldaten und deren Nachkommen in Deutschland auseinanderzusetzen. Afroamerikanische Soldaten waren maßgeblich an der Entnazifizierung Deutschlands beteiligt, während sie sich zuhause in den USA immer noch mit Jim Crow und der Segregation konfrontiert sahen. Unsere Gesprächsreihe im Rahmen der Studiengalerie 1.357 reaktiviert diese Geschichten, macht Schwarze Akademiker, Allies und deren Forschung im deutschen akademischen Kontext sichtbarer und stellt eine Kritik an dem ausschließenden System der Repräsentation dar.
Im Seminar und den zahlreichen Gesprächen ist mir aufgefallen, wie sehr deutsche universitäre Diskurse von den Debatten im anglo-amerikanischen Raum geprägt werden. Wissenschaftler:innen wie Fatima El-Tayeb oder Michelle M. Wright haben die Differenzen zwischen afroamerikanischer und afrodeutscher Geschichte herausgestellt und die daraus resultierenden unterschiedlichen Exklusionsmechanismen. Ist Dein Eindruck, dass die Fokussierung auf den anglo-amerikanischen Raum die Debatte über oder die Aufarbeitung spezifischer Erfahrungen Schwarzer deutscher Menschen eher verhindert?
Ich denke nicht, dass man Black Studies in nationalsprachlichen Dimensionen, also nur auf/in deutscher Sprache denken kann. Dafür ist die Schwarze Diaspora in Deutschland viel zu divers. Die akademische Arbeit um Black Studies gilt es grundsätzlich als international, interkontinental und transatlantisch zu verstehen. Es gibt viele Überschneidungen und historische Parallelen, die nicht nur zuletzt durch den Kolonialismus oder Migration geprägt sind. Debatten eins zu eins aus einem nordamerikanischen Kontext auf Deutschland zu übertragen oder auch das Vokabular problematischer Sprache einfach ins Englische zu übersetzen, da sich in der deutschen Sprache keine passenden Terminologien finden lassen, erscheinen dennoch zu bequem. Hier zeigen sich eindeutig die Leerstellen, Rückstände, aber auch Ausschlussmechanismen im deutschen Vokabular, der deutschen Mehrheitsgesellschaft, um angemessen über die Lebensrealität Schwarzer Menschen in Deutschland sprechen zu können. Diese Sprachlosigkeit lässt sich auch an deutschen Universitäten und in antidiskriminatorischen Diskursen feststellen. Die Lebensrealitäten Schwarzer Menschen, aber auch die sozio-politischen Bedingungen, variieren natürlich von Land zu Land stark und sollten auch immer unter diesem Aspekt betrachtet werden. Die deutsche Sprache läuft mit dem systematischen strukturellen Ausschluss von in Deutschland lebenden BIPOC Personen, aber auch der starken Anlehnung an das Anglo-Amerikanische, natürlich Gefahr, strukturellen und institutionellen Rassismus zu externalisieren und als etwas darzustellen, was es in dieser Form („ähnlich wie auch Schwarze Menschen selbst“) hier zu Lande nicht gibt.
Du bist bildender Künstler und erhältst viele Anfragen für Projekte. Was hat dich bewogen, Deine Arbeit nicht nur in der Studiengalerie zu zeigen, sondern auch im Rahmen eines Seminars an der Uni mit Studierenden zu diskutieren?
Eine notwendige Strategie für das Überleben meiner Praxis in deutschen Institutionen ist es leider, noch mein eigener Kunsthistoriker, mein eigener Kurator, mein eigener Vermittler zu sein. Es ist erstaunlich, wie wenig der weißen Mehrheitsgesellschaft in Deutschland über afrodeutsche Identitäten, Künstler*innen, Akademiker*innen und Geschichte bekannt ist. Wir haben das Privileg, auf mehrere Jahrhunderte Afrodeutscher Identität zurückblicken zu können und das Schwarzsein wurde hierzulande auch bereits seit den 1980ern auf vielen Ebenen von Schwarzen Feministinnen wie May Ayim, Ika Hügel-Marshall, Marion Kraft und vielen mehr verhandelt. Dennoch gibt es nach wie vor sehr wenig Repräsentation, Feingefühl oder Wissen im deutschen Mainstream. Unsere Positionen werden nach wie vor marginalisiert oder für vermeintliche Diversitätserfolge und Integration instrumentalisiert. Dass dieses Expertenwissen nicht mit der Hautfarbe zusammenhängt, verwundert auch immer wieder viele weiße Menschen. Während meines Studiums suchte ich bei Dozierenden vergeblich nach Referenzen. Deshalb begab ich mich wie viele meiner intergenerationalen Schwarzen Kolleg*innen ins englischsprachige Ausland, um dort nach Antworten zu suchen. Nach Deutschland zurückgekehrt, konnte ich meine Auslandserfahrungen erfolgreich mit meiner Praxis auf den deutschen Kontext übertragen.
Hier ist ein Zitat meiner Gesprächspartnerin Eleonore Wiedenroth-Coulibaly aus ihrem Beitrag in Farbe bekennen passend, mit der ich im Rahmen des Seminars zum Thema „Eine Sprache finden“ gesprochen habe:
„Mit der Zeit kam ich darauf, dass, wenn ich nicht nur überleben, sondern schlicht leben wollte, ich dies als erstes hier in der Bundesrepublik durchsetzen sollte. Schließlich bin ich hier zu Hause. Dies ist meine Heimat, auch wenn so viele meiner Mitbürger meinen, meine Heimat müsse dort sein, wo ich den Leuten äußerlich gleiche. Heimat ist ein innerer Bezugspunkt.“
Mir ist es jetzt wichtig, diese gesammelten Erfahrungen mit den BIPOC Student*innen an der Universität zu teilen. Repräsentation und Sichtbarkeit zu schaffen. Student*innen zu zeigen, wie stark die gesellschaftliche Fremdwahrnehmung in die persönliche Selbstwahrnehmung eingreift. Die mangelnde Diversität der Beschäftigten an deutschen Hochschulen spiegelt für mich nicht die Realität der Studierenden oder meiner wider. Sie spiegelt nicht das Bild wider, dass ich von Deutschland habe. Wenn der Kanon, der bestehende Status Quo sich selbst reproduziert, sehe ich wenig Potential, um der Unsichtbarkeit Schwarzer Lebenswege in der weißen Dominanzgesellschaft zu begegnen.
Du arbeitest mit der Kunsthistorikerin Mearg Negusse und dem Soziologen und Politikwissenschaftler Eric Otieno zusammen. Wie wichtig ist für Dich Austausch – speziell und generell?
Multidisziplinäre Kooperationen mit queeren und Schwarzen Kulturschaffenden sind die treibende Kraft meiner Praxis, die oft auf die Orte reagiert, an denen sie auftaucht. Aus der Not heraus sah ich mich schon während meines Studiums, aber auch jetzt, gezwungen, ein intergenerationales, intersektionales Netzwerk von Schwarzen Kulturproduzenten und Verbündeten zu kreieren, die in ähnlichen Diskursen arbeiten. Deutsche Kultur- und Bildungsinstitutionen und die vermeintlich objektiven Strukturen der offiziellen Geschichtsschreibung konnten mir kaum Inhalte vermitteln, die mich als deutsche, Schwarze und queere Person verorteten, meine Perspektiven ansprachen. Ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum meine Praxis so breit und multimedial gefächert ist und ich schon seit Anfang an transdisziplinär gearbeitet habe. Mit meiner Arbeit innerhalb dieser kollaborativen Strukturen von queeren, nicht-weißen Kulturproduzenten ist es mir möglich, Strategien anzuwenden, mit denen ich Formen weißer kapitalistischer Hegemonie entgegenwirken kann, die fließende Kanäle sozialer Mobilität auszumerzen. Meine Praxis ist daher ein Versuch, den Zugang zu genau diesen Kanälen wiederzuerlangen und diese Kanäle wieder auf sich selbst umzuschalten.
Wir haben zu Beginn des Seminars über die Schwierigkeit, eine Sprache zu finden, gesprochen. Ein Thema, dass Dich in Deiner Arbeit und in den deutschen Texten, die diese begleiten, konstant beschäftigt. Wie erlebst Du die Diskussionen im Seminar?
Genau, zu diesem Thema hatten wir Eleonore Wiedenroth-Coulibaly in der Gesprächsreihe im Eisenhowersaal zu Besuch. Eleonore baut bereits seit den 1980ern diesen Kanon um antidiskriminatorische Sprache in der deutschen Öffentlichkeit aktiv auf und erweitert diesen. Auf der Vorarbeit der ersten Generationen wie z.B, Theodor Wonja Michael und Marie Nejar und den darauffolgenden afrodeutschen Denker*Innen, Aktivisten*Innen und Kreativen fußt meine Praxis. Sie stellt einen reichen Fundus an Verhandlungen um Sprache, Terminologien und Begrifflichkeiten um das Schwarzsein in der deutschen Sprache dar, aus dem ich heute schöpfen kann. Im Seminar verhandle ich diese wiederum mit der nachfolgenden Generation. Unsere Arbeit und Diskussionen im Seminar finden an der Schnittstelle von bildender Kunst sowie historisch-politischer Bildung statt und verstehen sich als ein Beitrag zur Kanonerweiterung von (Kunst)geschichtsschreibung. Egal wie fortschrittlich die Wissenschaft auch sein mag, sie muss sich immer mit dem geschichtlichen Kontext, in dem sie verhandelt wird, auseinandersetzen. Das vorherrschende Paradox des institutionellen Rassismus stellt eines der schwierigsten Hürden für künftige BIPOC Künstler*innen und Akademiker*innen dar. Sprache ist fluide, sie wird immer wieder neu verhandelt und an unsere psychischen oder sozio-politischen Bedürfnisse angepasst. Sprache ist niemals unpolitisch oder neutral. In ihr lassen sich Brüche und Kontinuitäten, die sich als Mikrokosmos gesellschaftlicher Auseinandersetzungen im Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt sowie Geschichte lesen.