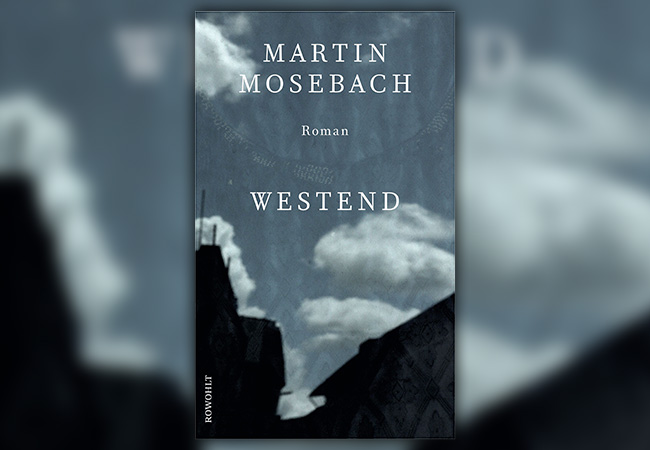
Martin Mosebachs Roman »Westend« aus dem Jahre 1992 steht im Fokus des diesjährigen Lesefestes »Frankfurt liest ein Buch«. Der UniReport konnte Mosebach im Vorfeld einige Fragen stellen.
Herr Mosebach, Ihr Roman »Westend« wird im Mai im Mittelpunkt des Lesefestes »Frankfurt liest ein Buch« stehen. Mit fast 900 Seiten ist das Buch schon ein vergleichsweise »dicker Schmöker« – haben Sie einen Tipp für die Leserinnen und Leser, wie man sich durch die schiere Masse an Figuren, Beziehungen und Geschichten »durchkämpft«?
Ich finde die Vorstellung, sich durch ein Buch hindurchzukämpfen, nicht sehr erfreulich. Dicke Bücher haben es allerdings an sich, dass es oft schwerfällt, sie in einem Zug zu lesen, schon aus Zeitgründen. Aber meine Geschichte ist nicht so kompliziert, dass der Leser, der sich darauf einlässt, große Schwierigkeiten haben müsste, sich darin zurechtzufinden. Der Stoff sammelt sich im Grunde um wenige Personen und ist hintereinander weg erzählt. Was mich an ihm interessierte, war vor allem das Verstreichen der Zeit und die für die Zeitgenossen selbst unmerkliche Veränderung ihrer Mentalität. Davon eine Ahnung zu vermitteln braucht natürlich einen gewissen Raum, das ist kein Stoff für eine Kurzgeschichte. Zugleich habe ich die Vorgänge aber so vereinfacht – gegenüber der tatsächlich unübersichtlichen Realität –, dass ich hoffe, man kann ihnen ohne Anstrengung folgen, wenn man überhaupt bereit ist, dem Roman ein Stück Lebenszeit zu schenken.
»Westend« ist ein vielschichtiger Gesellschaftsroman, der anhand der Familien Has und Labonté gewissermaßen die Abgründe und Chancen, die Verlierer und Gewinner der Nachkriegszeit charakterisiert. Bestätigt der Roman Tolstois These, wonach alle glücklichen Familien einander gleichen, jede unglückliche Familie aber auf ihre eigene Weise unglücklich ist? Oder dementiert er sie eher?
Das berühmte Tolstoi-Aperçu teilt mit vielen Worten dieser Art, dass man ihm zunächst zustimmt, um dann festzustellen, dass auch das Gegenteil davon richtig ist. Es gibt so viele Arten glücklich zu sein. Die Literatur beschäftigt sich allerdings lieber mit dem Unglück, es ist leichter zu fassen – das Glück ist dem Glücklichen oft unsichtbar.
»Westend« hat bei seinem Erscheinen im Jahre 1992 keine sehr große Resonanz erzielt. Denken Sie, dass der Roman 25 Jahre später den Leser gerade deswegen in den Bann ziehen kann, weil in Großstädten wie Frankfurt soziale Biotope und Nachbarschaften austauschbarer werden? Entsteht zunehmend eine neue Sehnsucht nach »Heimat«, nach Verwurzelung und sozialer Eingebundenheit?
Es stimmt, „Westend“ hatte bei Erscheinen nicht viel Aufmerksamkeit. Die Kritiker damals gehörten einer älteren Generation an; ich habe Verständnis für meine Bücher erst gefunden, als eine beträchtlich jüngere Generation begann, sich mit mir zu beschäftigen. Ich höre, dass es gegenwärtig eine größere Sehnsucht nach Heimat und Verwurzelung gebe – die würde durch dies Buch allerdings kaum befriedigt, das eher die Auflösung solcher Phänomene zum Gegenstand hat, und zwar als einen unsteuerbaren, unbeeinflussbaren Prozess, als den nostalgischen Blick zurück.
Einige Kritiker haben den Erzählstil des Romans als altmodisch und manieriert beschrieben; steht dieses eher am Ton des 19. Jahrhunderts orientierte Erzählen für Sie für einen bestimmten Blick auf Welt und Gesellschaft, benötigt es dafür eines archimedischen Punktes?
Was als altmodisch empfunden wurde, war eine Form des Einverstandenseins mit der vorgefundenen Sprache, eine Unlust, die Sprache als Problem zu betrachten. Mir war vor allem wichtig, eine Geschichte zu erzählen, die Problematisches genug enthielt, um noch durch ihr Vehikel, die Sprache, zusätzliche Hindernisse aufgebürdet zu bekommen. Inzwischen sind zahllose Werke entstanden, die ebenso „altmodisch“ erzählen. Im Übrigen genügt ein Blick auf die Erzähler des 19. Jahrhunderts, Stifter, Raabe, Fontane, um schnell festzustellen, dass meine Sprache eine andere ist. Mein Traum ist etwas, was es natürlich gar nicht geben kann – eine eigenschaftslose Sprache, die zwischen das Innere Bild des Autors und das in seinen Lesern erzeugte Bild keine Distanz legt.
Ihr Roman beschreibt in einem Zeitraum von 30 Jahren auch den städtebaulichen Wandel des Westend. Der Bau von Hochhäusern ab den 60er-Jahren erscheint als eine zerstörerische Kraft. Was ist Ihrer Meinung nach verloren gegangen? Wie sehen Sie die weitere Entwicklung der Stadt Frankfurt seitdem, was gefällt Ihnen?
Ich hatte ursprünglich gar nicht vor, mich explizit mit Frankfurt zu beschäftigen und habe mich zunächst sogar heftig gegen den vom Verlag präferierten Titel „Westend“ gewehrt. Aber ich habe dann akzeptiert, dass historische Vorgänge, und um die ging es mir, nicht im luftleeren Raum stattfinden. Also habe ich dann ein Frankfurt geschildert, dass aber zu großen Teilen meiner Fantasie entstammte. Da gab es das verrückte Faktum, dass in einer in ihrem Zentrum schwer zerstörten Stadt ausgerechnet das Viertel, das den Krieg einigermaßen überstanden hatte, nun auch noch abgerissen werden sollte. Ich habe gar nichts gegen Hochhäuser, sie wurden in Frankfurt nur an der falschen Stelle gebaut. Die Stadtplaner des späten 19. Jahrhunderts hatten als Erweiterungsgebiet der alten Stadt die Mainzer Landstraße zwischen Bahnhof und Festhalle vorgesehen, hier gab es innenstadtnahen Platz in Hülle und Fülle, aber stattdessen mussten die Hochbauten in den mittelalterlichen Kataster gezwängt werden. Aber solche Vorgänge sind nie einfach nur Fehler, sie gehorchen auch historischen Notwendigkeiten. Die Stadtplaner oder besser die Nicht-Stadtplaner der 60er-Jahre hatten einfach aus den Augen verloren, was eine Stadt eigentlich ist – das war ja keineswegs nur in Frankfurt so. Verglichen mit andern Vierteln des späten 19. Jahrhunderts ist das Westend auch gar nichts Besonderes, ich habe es in aller Freiheit der Erfindung nur genommen, weil mir dies Beispiel am nächsten lag.
Und was halten Sie von der neuen Altstadt?
Die neue Altstadt – für mich ist das der Versuch einer notwendigen Reparatur, dem bedeutendsten Bauwerk Frankfurts, dem spätgotischen Domturm von Madern Gerthener, einen Rahmen zu geben, der ihn wieder voll zur Geltung bringt. Der Turm hat den Krieg überlebt, aber stand seitdem in einer Umgebung, die ihn herabgewürdigt hat.
Sie wohnen selber im Westend und beobachten auch den Wandel dort. Hat der Umzug der Goethe-Universität auf den Campus Westend den Stadtteil verändert?
Die Universität gehörte ja nicht zum Westend, sondern zu Bockenheim und war auch auf diesen Stadtteil ausgerichtet, dort wohnten viele Studenten. Die neue Universität ist sehr stattlich, eine Art blitzblanke Bauausstellung, die einem ganz anderen Studententypus entspricht als dem, der mit dem Bockenheimer Campus verbunden war. Die alten Ferdinand-Kramer- Bauten waren frostig-technizistisch und wurden durch jede Menge Dreck „humanisiert“. Es fällt schwer, sich die Studenten von vor 30 Jahren in dieser neuen Umgebung vorzustellen. Auch das ist ein Prozess des Mentalitätswandels, der eigentliche Stoff, aus dem die Geschichte besteht.
Die Fragen stellte Dirk Frank
Im Universitätsarchiv der Goethe- Universität wird die Ausstellung ORTSTERMIN vom 6. bis 19. Mai in der Dantestraße 9 die den Roman prägende Kunst, Architektur und Alltagskultur zeigen.
Die Ausstellungseröffnung ist am 5. Mai.
Mehr zu Frankfurt liest ein Buch 2019:
https://www.frankfurt-liest-ein-buch. de/2019
Dieser Artikel ist in der Ausgabe 2.19 des UniReport erschienen.













