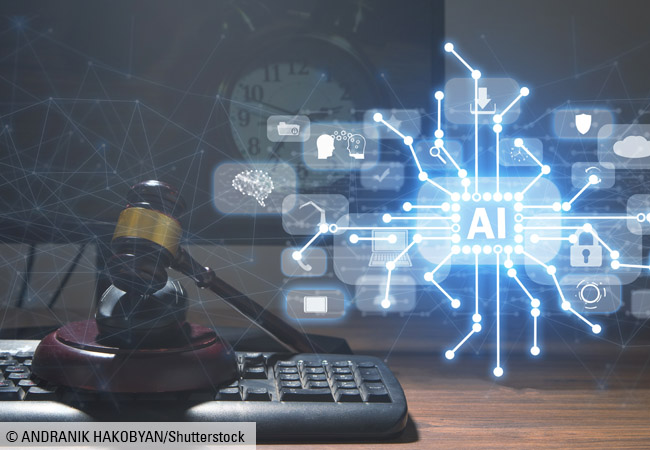Mit dem im vergangenen Jahr erschienenen Buch „Kopftuch und Burka. Laizität, Toleranz und religiöse Homogenität in Deutschland und Frankreich“ des Rechtswissenschaftlers und früheren Präsidenten der Goethe-Universität, Prof. Dr. Rudolf Steinberg, setzt sich der Frankfurter Rechtswissenschaftler PD Dr. Felix Hanschmann in seiner Rezension detailliert auseinander. Er kommt zu dem Urteil: „ein in weiten Teilen bemerkenswert unaufgeregtes und im besten Sinne ‚aufklärerisches‘ Buch“.
I. Xenophobie breitet sich wieder aus. Gewaltsame Angriffe auf Flüchtlinge und deren Unterkünfte häufen sich. In Kommentarspalten von Online-Zeitungen, in Foren und sozialen Netzwerken begegnet einem die hässliche Fratze eines sich aus der (trügerischen) Anonymität des Internets Bahn brechenden Rassismus. Selbst antisemitische Äußerungen sind wieder deutlicher zu vernehmen. Im Fokus der Angst und der Wut steht spätestens seit dem 11. September 2001 jedoch „der“ Islam, der nicht selten mit Islamismus in einen Topf geworfen und ebenso kategorisch wie unabänderlich als unvereinbar mit einem auf Demonstrationen und nächtlichen Spaziergängen verteidigten christlichen Abendland erklärt wird.
In dieser Situation hat Rudolf Steinberg ein in weiten Teilen bemerkenswert unaufgeregtes und im besten Sinne „aufklärerisches“ Buch geschrieben. Es handelt von jenen Kleidungsstücken, die in den letzten Jahren in vielen Ländern zu zahlreichen Gerichtsentscheidungen auf unterschiedlichen Ebenen, zu einer Flut an (rechts-)wissenschaftlichen und zunehmend auch belletristischen Beiträgen, Gesetzen und politischen, gesellschaftlichen sowie medialen Diskussionen geführt haben. Es ist, das sei vorweggenommen, ein Buch geworden, das aufzeigt, wie religiös und auch sonst hochgradig pluralistische Gesellschaften rational, freiheitlich und diskriminierungsfrei mit Differenz umgehen könnten.
II. „Kopftuch und Burka. Laizität, Toleranz und religiöse Homogenität in Deutschland und Frankreich“ ist in sechs Kapitel unterteilt. Nach einer knappen Einleitung setzen sich das zweite und das dritte Kapitel zunächst mit dem Tragen des Kopftuchs in der Schule und in nicht staatlichen Bereichen auseinander. Während es in Deutschland in erster Linie um das Kopftuch der Lehrerin geht, konzentrieren sich die Ausführungen zu Frankreich auf das – in der deutschen Rechtswissenschaft als unproblematisch vom Grundrecht der Religionsfreiheit geschützt betrachtete und von den Landesgesetzgebern bislang nicht unterbundene – Tragen von Kopftüchern durch muslimische Schülerinnen. Dargestellt werden darüber hinaus Konflikte um das Kopftuch in anderen Bereich des öffentlichen Dienstes (z.B. bei der Polizei oder in der Gerichtsbarkeit), in Wirtschaftsunternehmen (Verkäuferin im Kaufhaus), im Kindergarten (Erzieherin) oder in Krankenhäusern (Krankenschwester). Konzentriert auf die tragenden Argumente werden die wichtigsten Gerichtsentscheidungen aus Frankreich und Deutschland zusammengefasst und kritisch hinterfragt.
Deutlich werden dabei schon die Positionen, die Rudolf Steinberg im weiteren Verlauf zumeist mit überzeugenden Argumenten vertritt, aber auch die Differenziertheit der Beobachtung von Phänomenen, die anderswo nicht selten holzschnittartiger präsentiert werden. Wo sich Gerichte oder Gesetzgeber zur Stützung der jeweils eigenen Position nur oberflächlich und selektiv bei der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts oder juristischen Beiträgen bedienen, analysiert Rudolf Steinberg die in Bezug genommenen Entscheidungen und Beiträge genauer. Er zeigt, dass beispielsweise das Bundesarbeitsgericht und das Bundesverwaltungsgericht mit einer am Ergebnis der eigenen Entscheidungen orientierten Lektüre der Urteile des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungsmäßigkeit der christlichen Gemeinschaftsschulen die ihrer Ansicht nach verfassungsrechtlich zulässige Privilegierung christlicher und jüdischer Symbole zu stützen versuchen, dabei aber die in den Karlsruher Judikaten betonte „Offenheit gegenüber dem Pluralismus weltanschaulich-religiöser Anschauungen“ (mit Absicht?) unter den Tisch fallen lassen.
Mit Verweis auf empirische Daten und unter Bezugnahme auf eine beeindruckende, jedoch keineswegs wahllos zusammengetragene Menge an Literatur warnt der Autor vor voreiligen Zuschreibungen, mit denen Kopftuch tragenden Frauen bestimmte Motivationen unterstellt werden, aber auch vor der Reduktion des Kopftuchs allein auf die symbolische Repräsentation von dem normativen Koordinatensystem des Westens entgegenstehenden oder gar feindlich gesinnten Aussagen oder Ideologien. In einer scharfen Kritik derjenigen landesgesetzlichen Regelungen, mit denen einzelne Bundesländer nach dem ersten Kopftuch-Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 2003 in kaum verhohlener Diskriminierungsabsicht versucht haben, christliche und jüdische Symbole und Kleidungsstücke mit dem Argument der angeblich notwendigen Berücksichtigung kultureller Prägungen durch ein – nebenbei bemerkt: dadurch vollständig profanisiertes – Christentum gegenüber dem Kopftuch zu privilegieren, klingt schon eine wesentliche Forderung des Buches an: Religionsfreiheit in der pluralistischen Gesellschaft kann und darf es nur noch unter Einhaltung des Gebotes strikter Gleichbehandlung geben. Denn jede exekutive oder gar schon im Gesetz angelegte Diskriminierung kommuniziert unabhängig von den hierfür angestellten argumentativen Klimmzügen immer nur eines: Ihr habt nicht die gleichen Rechte wie wir, weil ihr anders seid.
In diesem Zusammenhang wird, was in neueren juristischen Arbeiten nicht häufig passiert, schließlich immer wieder erinnert an die Bildungs- und Erziehungsziele in den Landesverfassungen und Schulgesetzen der Bundesländer, die für die Schule das Lernen und Einüben von Toleranz (z.B. Art. 15 Abs. 4 Verf. M-V, Art. 27 Abs. 1 Verf. LSA, Art. 22 Abs. 1 Verf. Thür.) beziehungsweise der Achtung vor den (religiösen) Überzeugungen (z.B. Art. 131 Abs. 2 BayVerf., Art. 28 BbgVerf., Art. 7 Abs. 2 Verf. NRW) propagieren. Eine an diesen Zielen orientierte schulische Erziehung in der Praxis umzusetzen, wird allerdings, wie Rudolf Steinberg richtig bemerkt, schwierig, wenn die Konfrontation mit Andersgläubigen (jedenfalls in Gestalt der Lehrkräfte) von vornherein unterbunden wird, weil jene Tugenden, die Kinder und Jugendliche in der Schule lernen sollen, vom Gesetzgeber missachtet werden.
III. Im vierten Kapitel wird die Vollverschleierung durch das Tragen einer Burka oder eines Niqab thematisiert. Mangels gesetzlicher Regelungen in Deutschland konzentriert sich der Autor dabei zunächst auf Diskussionen und gesetzliche Regelungen in Frankreich. Erinnert man die Argumentation aus den vorangegangenen Kapiteln, stellen sich hier indes Irritationen ein. Denn sicherlich gibt es gute Gründe, Unterschiede zwischen der rechtlichen Behandlung des Kopftuchs einerseits und einer Vollverschleierung andererseits zu machen. So ist abgesehen von Täuschungsmöglichkeiten die schulische Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern zweifellos darauf angewiesen, dass die Beteiligten auch die Mimik der jeweils anderen wahrnehmen können.
Wenn jedoch eine arg konstruiert anmutende „westliche Kultur des visuellen Systems“ beziehungsweise eine „Ordnung des Sichtbaren“ zur „sozialen Grundlage“ einer „offenen Bürgergesellschaft“ erklärt und „die Unvereinbarkeit des Burka-Tragens mit fundamentalen Grundlagen der westlichen Gesellschaft“ apodiktisch behauptet werden, anders als noch bei der Erörterung des Kopftuchs die Möglichkeit divergenter Motivationen verschleierter Frauen aber nicht einmal angedacht, stattdessen aber Fremdzuschreibungen vorgenommen werden und diesen Frauen ohne empirische Evidenz unterstellt wird, „dass sie gegen die Erwartungen eines Mindestmaßes an sozialer Übereinstimmung verstoßen“, dann ist das in dieser Allgemeinheit nur schwer in Einklang zu bringen mit den zuvor für das Tragen des Kopftuchs angeführten Argumenten.
Auch die Aussage, ein Burka-Verbot solle – wenn auch nur in „Grenzfällen“ (welche sind das?) – dann angebracht sein, „wenn die Vollverschleierung als Teil eines Kampfes gegen den politisch aggressiven Salafismus angegangen werden soll“, vermag nicht zu überzeugen. Denn dadurch werden Frauen, die eine Burka tragen, ohne Rücksicht auf ihre Ansichten und ihr konkretes Verhalten und ungeachtet der Tatsache, dass – wie auch Rudolf Steinberg klarstellt – das Tragen einer Burka in den Schutzbereich des Grundrechts der Religionsfreiheit fällt, als Stellvertreterinnen einer extremen politischen Richtung in Beschlag genommen und zur Erreichung eines politischen Zieles instrumentalisiert. Zur Rechtfertigung der mit einem Burka-Verbot einhergehenden Eingriffe in die Religionsfreiheit auf einen mit der „Kultur der Sichtbarkeit“ angereicherten und „nach innen wirkenden ordre public“ oder auf den mit guten Gründen nur noch selten verwendeten Begriff der „öffentlichen Ordnung“ zurückzugreifen, erscheint in mehrfacher Hinsicht fragwürdig.
Zum einen weisen die Rechtsgüter, auf die zur Einschränkung der Religionsfreiheit rekurriert wird, eine nicht unbeträchtliche Unbestimmtheit auf. Zum anderen kann man sich nur schwer des Eindrucks erwehren, erneut mit einem Phänomen konfrontiert zu sein, dass sich in der Vergangenheit bereits in gerichtlichen Entscheidungen zur Unzulässigkeit von Peepshows, des Werfens von Kleinwüchsigen auf Jahrmärkten oder der simulierten Tötung in sogenannten Laserdromes gezeigt hat: ein jedenfalls nach Aussage der Betroffenen selbstbestimmtes Handeln wird über die Begriffe des „ordre public“ und der „öffentlichen Ordnung“ in paternalistischer Manier unterbunden. Nicht zuletzt aus diesem Grund erweckt der Rückgriff auf die genannten Rechtsgüter oft den negativen Eindruck, dass sie nur dann aus der Mottenkiste rechtlicher Argumentation herausgeholt werden, wenn ein aus welchen Gründen auch immer gewolltes Ergebnis auf andere Weise überzeugend und konsistent nicht begründet werden kann. Dass ein Burka-Verbot in Deutschland aufgrund der geringen Zahl der davon betroffenen Frauen mangels Erforderlichkeit unverhältnismäßig und im Übrigen auch verfassungspolitisch kontraproduktiv wäre, wie Rudolf Steinberg zutreffend schreibt, beseitigt jedenfalls nicht die Zweifel an der grundsätzlichen Kritikwürdigkeit der dogmatischen Begründung von Eingriffen in ein grundrechtlich geschütztes Verhalten.
IV. Im fünften und längsten Kapitel geht es um die nur auf den ersten Blick krass divergenten religionsverfassungsrechtlichen Ordnungsmodelle in Frankreich und Deutschland, die gewissermaßen das Flussbett der in den ersten Kapiteln dargestellten Konflikte und Rechtsfragen bilden. Detailreich und historisch informiert beschreibt Rudolf Steinberg das französische Prinzip der Laizität, das gemeinhin mit einer strikten Trennung von Staat und Kirche identifiziert wird, und das aus einer komplexen Gemengelage vielfältiger Akteure, Interessen und Faktoren in der Weimarer Republik geprägte deutsche Modell, das bei prinzipieller Geltung der Gebote staatlicher Neutralität und institutionell-funktioneller Trennung von Staat und Religionsgemeinschaften zahlreiche Bereiche der Verbindung und der Kooperation aufweist (so z.B. beim Religionsunterricht, dem Körperschaftsstatus, der Anstaltsseelsorge und der Erhebung von Kirchensteuern oder bei der Einrichtung theologischer Fakultäten an staatlichen Universitären).
Abseits der historisch und konzeptionell notwendigerweise unterkomplex bleibenden Bildung von Idealmodellen und deren schroffer Gegenüberstellung wird im Folgenden dann aber nicht nur gezeigt, dass die religionsverfassungsrechtlichen Ordnungen in Frankreich und Deutschland vor denselben Herausforderungen und Problemen stehen, was seine Ursache vor allem darin findet, dass die Bevölkerungen in beiden Ländern in religiös-weltanschaulicher Hinsicht irreversibel heterogener geworden sind. Zu beobachten ist vor allem eine zunehmende Konvergenz der beiden Modelle, wobei sich das in einem tief greifenden und heftig umkämpften Wandel begriffene Prinzip der Laizität eher an das kooperativere und bislang von der Offenheit des staatlichen Bereichs für die Religion geprägte deutsche Modell annähert. Semantisch findet dies seinen Niederschlag in der Rede von einer „laïcité ouverte“ oder einem „principe d’inclusion“. Dass die im Fluss befindlichen Entwicklungen jedoch überaus komplex sind und alles andere als linear verlaufen, ruft Rudolf Steinberg durch einen Verweis auf die erste Kopftuch-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Erinnerung. Denn dort ist umgekehrt eine Bewegung des deutschen Modells hin zum französischen Prinzips der Laizität insofern zu beobachten, als das Gericht zur Vermeidung eventuell entstehender Konflikte beziehungsweise zur Abwehr möglicher Beeinträchtigungen der Funktion der Schule als Bildungs- und Erziehungseinrichtung eine „striktere und mehr als bisher distanzierende“ Lesart der staatlichen Neutralitätspflicht im schulischen Bereich, d.h. die Verbannung der Religion aus der staatlichen Schule, ins Spiel gebracht hat. (BVerfGE 108, 282 [310]).
Ganz unabhängig von der eigenen Meinung begrüßt man es als Leser, dass sich Rudolf Steinberg in den Diskussionen um das zukunftsfähigere und für pluralistische Gesellschaften besser geeignete religionsverfassungsrechtliche System klar positioniert, indem er für das deutsche Modell streitet. Mitnichten mündet das aber wiederum in einer unkritischen Affirmation der religionsverfassungsrechtlichen Ordnung des Grundgesetzes. Da historisch und konzeptionell an den christlichen Kirchen orientiert, müsse sich diese Ordnung nämlich im Interesse der Gleichbehandlung islamischer und anderer nichtchristlicher Gemeinschaften öffnen und stärker flexibilisiert werden. Freilich sieht man sich hier mit einer schwierigen Situation konfrontiert, die von Rudolf Steinberg vernachlässigt wird: Entweder das Religionsverfassungsrecht kapituliert vor der Vielfalt, Unübersichtlichkeit und Unterschiedlichkeit religiöser Phänomene, auf die es Anwendung finden soll, liefert sich dem Selbstverständnis der Grundrechtsträger aus und riskiert damit, Ansprüche an dogmatische Rationalität herunterzuschrauben. Oder aber das dann besser wieder Staatskirchenrecht genannte Rechtsgebiet verbarrikadiert sich hinter einem status quo, in dem die überschaubaren Verhältnisse vergangener Zeiten konserviert und nichtchristliche Religionen und Weltanschauungen am Maßstab der christlichen Kirchen gemessen werden.
Wahrscheinliche Folge davon wäre die Verbreitung eines desintegrative Effekte provozierenden Eindrucks ungerechtfertigter Ungleichbehandlungen. Damit in Zusammenhang steht das in der religionsverfassungsrechtlichen Literatur intensiv diskutierte Problem, ob und wie sich der Staat an der Herausbildung eines verfassungsfreundlichen Islam beteiligen kann, ohne dabei in unzulässiger Weise in die Garantie der individuellen und kollektiven Religionsfreiheit einzugreifen. Weil Prozesse staatlich initiierter Gesprächskreise oder die universitäre Etablierung von Professuren für islamische Religion zur Ausbildung islamischer Religionslehrerinnen und Religionslehrer sowohl für Frankreich als auch für Deutschland beschrieben werden, hätte es sich in einem Kapitel über die religionsverfassungsrechtlichen Systeme der beiden Länder angeboten, auch auf die hierdurch hervorgerufenen Rechtsfragen etwas näher einzugehen. All das sind indes Marginalien, gewinnt man in diesem Kapitel doch insbesondere aus der umfang- und materialreichen Beschreibung der französischen Diskussionen und Erfahrungen mit der Ausgrenzung der Religion aus der Schule neue Einsichten, die für den Umgang mit religiöser Pluralität in Deutschland mehr als wertvoll sind.
V. Unter der Überschrift „Homogenität und Identität in einem multireligiösen Gemeinwesen“ widmet sich Rudolf Steinberg im letzten Kapitel schließlich der Frage, was pluralistische Gesellschaften zusammenhält. Gesucht wird das „unabdingbar Gemeinsame“, „das gemeinsame Fundament“ oder einfach „das Gemeinsame“. Ausgegangen werden kann dabei nicht mehr von substanziellen, essenzialistischen und hermetisch geschlossenen Homogenitäts- und Identitätskonzepten, auch wenn solche derzeit in vielen Ländern eine Wiederbelebung am rechten politischen Rand erleben. Auch vermeintlich Vor-Gegebenes ist heute hinreichend dekonstruiert, mit Blick auf das Demokratieprinzip als problematisch erkannt und konstruktive Elemente sind von Historikerinnen und Historikern vor allem in Bezug auf Nationalgeschichten offengelegt worden. Einrichtungen oder Instanzen, die in früheren Zeiten noch in der Lage waren, ein relativ großes Maß an Homogenität von Wertvorstellungen und Verhaltensweisen zu garantieren, haben schließlich massiv an Bedeutung eingebüßt. Deshalb ist es nur folgerichtig, dass Rudolf Steinberg von einem konstruktivistischen Ansatz ausgeht, der es als permanente Herausforderung und Aufgabe versteht, die Entstehung unversöhnlicher und unüberbrückbarer Antagonismen in der Gesellschaft zu unterbinden, Differenz zugleich aber anzuerkennen und effektiv zu schützen.
Nicht nur bei Juristinnen und Juristen liegt es nahe, dass sie dabei der „Sozialisation aller Staatsbürger in einer gemeinsamen politischen Kultur“ (Jürgen Habermas) eine zentrale Bedeutung beimessen. Dabei belässt es Rudolf Steinberg jedoch nicht. Mindestens ebenso bedeutsam ist, so könnte man seine Schlussfolgerungen zusammenfassen, dass individuelle oder kollektive Exklusionserfahrungen nicht ein Ausmaß annehmen, welches bei den davon Betroffenen das Gefühl erzeugt, weniger Chancen zu haben als andere und nicht wirklich gleichberechtigter Teil einer Gesellschaft zu sein. Denn wenn Diskriminierungen entlang ethnischer oder sozioökonomischer Kriterien bereits in der Schule beginnen, sich bei der Integration ins Berufsleben oder bei der Suche nach einer Wohnung fortsetzen und in einer räumlichen Segregation münden, dann dürfte ein von Eliten propagierter Verfassungspatriotismus wenig helfen, weil dessen Bezugspunkte von den Diskriminierten und Ausgeschlossenen bestenfalls als lyrische Farce wahrgenommen werden. Anders als jene, die auf die Heterogenität, Pluralität und Komplexität europäischer Gesellschaften mit Abschottung und Ressentiments gegenüber allem Fremden reagieren, negiert Rudolf Steinberg weder die Schwierigkeiten der Herausforderungen noch suggeriert er einfache Lösungen.
Zur Bearbeitung permanent vorhandener Dissense und Konflikte bedarf es nicht nur politischer und gerichtlicher Verfahren. Den Bürgerinnen und Bürgern werden vielmehr auch bestimmte Einstellungen und Leistungen abverlangt. Es zeichnet das Buch Rudolfs Steinbergs in besonderer Weise aus, dass er es nicht bei wohlfeilen Appellen und Mahnungen belässt. Das Beharren auf einer differenzierten Beobachtung und Bewertung, die Bereitschaft und Fähigkeit zur Infragestellung und Kritik der eigenen Positionen und Meinungen, das Bemühen, sich in die Lage und die Sichtweisen von Minderheiten hineinzuversetzen und die manchmal schmerzhafte Toleranz gegenüber nicht geteilten Überzeugungen und Praktiken durchziehen vielmehr sein gesamtes Buch.
[dt_call_to_action content_size=“normal“ background=“plain“ line=“false“ style=“1″ animation=“fadeIn“]
 Rudolf Steinberg, Kopftuch und Burka. Laizität, Toleranz und religiöse Homogenität in Deutschland und Frankreich, Baden-Baden 2015, Nomos Verlag, ISBN 978-3-8487-2855-8, 256 Seiten, 38 Euro.
Rudolf Steinberg, Kopftuch und Burka. Laizität, Toleranz und religiöse Homogenität in Deutschland und Frankreich, Baden-Baden 2015, Nomos Verlag, ISBN 978-3-8487-2855-8, 256 Seiten, 38 Euro.
[/dt_call_to_action]
[dt_call_to_action content_size=“small“ background=“fancy“ line=“true“ style=“1″ animation=“fadeIn“]
Der Rezensent
PD Dr. Felix Hanschmann, 43, ist Akademischer Rat am Fachbereich Rechtswissenschaft der Goethe-Universität. Er studierte Rechtswissenschaft und Soziologie in Frankfurt und Darmstadt. Seine Arbeitsschwerpunkte sind: Verfassung- und Verwaltungsrecht, insbesondere Schulrecht, Völkerrecht und Rechtstheorie. Derzeit vertritt Hanschmann eine Professur für Öffentliches Recht, Völkerrecht, Rechtsvergleichung und Rechtsethik an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg.
[/dt_call_to_action]