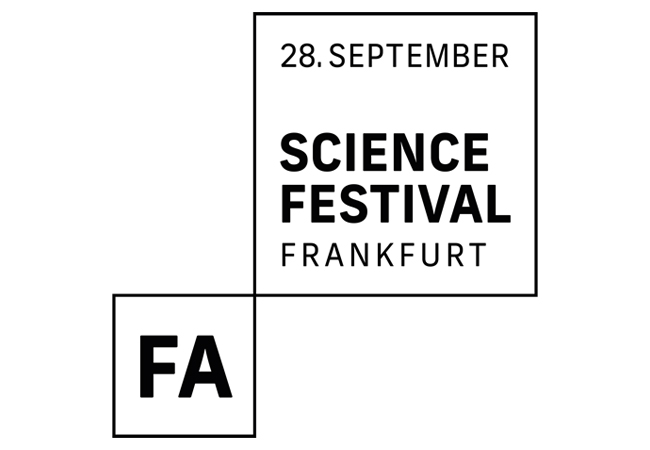Prof. Hartmut Leppin ist seit 2001 Professor für Alte Geschichte an der Goethe-Universität. Er erforscht die politische Ideengeschichte des Klassischen Griechenlands und die Geschichte des Christentums in der Antike. Dabei nimmt er eine Zeitspanne von 600 Jahren in den Blick – von Christi Geburt bis zu den Anfängen des Islam. 2014 erhielt Hartmut Leppin den Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), den höchstdotierten deutschen Forschungsförderpreis.
Herr Prof. Leppin, was hat Sie an der Würdigung durch den Leibniz-Preis besonders gefreut?
Der Leibniz-Preis ermöglicht mir neue Gestaltungsfreiheiten für meine Forschung, und ich freue mich über das Vertrauen, das es mir ermöglicht, bisher übersehene historische Entwicklungen durch die von mir gewählten Fragestellungen herauszuarbeiten. Das antike Christentum zeichnet sich durch eine große Vielfalt aus, die bisher wenig in den Blick gekommen ist. So sind die georgischen, armenischen oder koptischen Ausprägungen bisher wenig erforscht. Auch auf Alt-Syrisch, einer fast ausgestorbenen Sprache der dort ansässigen Christen, die heute nur noch Wenige beherrschen, wurden bedeutsame Texte verfasst. Über dieses zeitintensive Quellenstudium möchte ich Zugänge zu den christlichen und weiteren Kulturen schaffen, die nicht nur in historischer Perspektive aufschlussreich sind, sondern auch zum aktuellen Austausch über das Verhältnis der Religionen zueinander beitragen.
Wie wollen Sie Ihre Forschungsschwerpunkte setzen?
Mein Ziel ist es unter anderem, besser zu erkennen, über welche Kanäle welche Kulturen miteinander interagierten und in welchem Umfang das christliche Reich religiöse und kulturelle Vielfalt zuließ oder begrenzte. Damit können wir auch eine Brücke zur Erforschung des frühen Islam schlagen, der sich intensiv mit dem Christentum auseinandersetzte. Insgesamt möchten wir auch einen Beitrag zu der Frage leisten, wie sich die Ausbreitung der drei monotheistischen Religionen historisch ausgewirkt hat.
[dt_call_to_action content_size=”normal” background=”fancy” line=”true” style=”1″]
[vc_toggle title=”Zur Person Prof. Hartmut Leppin” style=”square” el_id=”1446040522748-fab84964-25f2″ css=”.vc_custom_1446052456701{margin-top: 20px !important;}”]Prof. Hartmut Leppin (51) wirkt mit seiner geschichtswissenschaftlichen Arbeit an zahlreichen interdisziplinären Forschungsverbünden an der Goethe-Universität mit, darunter dem Exzellenzcluster »Die Herausbildung normativer Ordnungen«, dem Forschungszentrum Historische Geisteswissenschaften und dem Graduiertenkolleg »Theologie als Wissenschaft«. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert seine Arbeit im Rahmen des Leibniz-Preises – Leppin ist der 16. Preisträger der Goethe-Universität –, des Sonderforschungsbereichs »Schwächediskurse und Ressourcenregime«, dessen Sprecher Leppin ist, und des Reinhart Koselleck-Programms. Besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfuhr sein Buch »Das Erbe der Antike« aus dem Jahr 2011, in dem Leppin anschaulich den Ursprung des heutigen Europas im antiken Mittelmeerraum verortet. Leppin studierte Geschichte, Latein, Griechisch und Erziehungswissenschaften in Marburg, Heidelberg und Pavia. Nach dem Ersten Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien wurde er 1990 in Marburg mit einer Studie über römische Bühnenkünstler promoviert. 1995 folgte die Habilitation an der Freien Universität Berlin mit einer Arbeit über die griechischen Kirchenhistoriker des 5. Jahrhunderts nach Christus. Leppin ist Vertrauensdozent der Studienstiftung des deutschen Volkes, Fachkollegiat der DFG sowie Beirat und Mitherausgeber verschiedener Fachpublikationen.[/vc_toggle]
[/dt_call_to_action]
Wie gehen Sie diese Fragestellungen an?
Die wichtigste Grundlage für meine Forschung bilden die antiken Schriften. Während die lateinischen und griechischen Quellen gut erschlossen sind, sind für die nicht klassischen Sprachen noch nicht alle erhaltenen Texte veröffentlicht oder gar übersetzt. Ich kann zwar Quellen in drei alten Sprachen lesen, doch das reicht keineswegs aus …! Daher sind für mich der Dialog und die Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern aus den entsprechenden Ländern sehr wertvoll, um neue Einblicke zu gewinnen und Zusammenhänge zu erkennen.
Was verbirgt sich hinter dem Titel des 2014 bewilligten Sonderforschungsbereichs »Schwächediskurse und Ressourcenregime«, dessen Sprecher Sie sind?
In den Arbeiten der 50 beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geht es um die Frage, wie die gesellschaftliche Diskussion über eine wahrgenommene Schwäche die Suche nach alternativen Ressourcen beflügelt. Diese Ressourcen können Rohstoffe, aber genauso Wissen, Glaube oder Nationalismus sein. Die untersuchten Kulturen, Regionen und Zeiträume liegen zum Teil scheinbar weit auseinander – sie reichen von der Antike bis in die Gegenwart – und die Forscher stammen aus unterschiedlichen Fachdisziplinen; sie sind Historiker, Ethnologen, Philosophen und Rechtshistoriker. Doch erst durch diesen globalhistorischen Ansatz werden Vergleiche auf einer übergeordneten Ebene und neue grundsätzliche Erkenntnisse möglich. Mit dem Budget von insgesamt sechs Millionen Euro für vier Jahre können wir talentierte Nachwuchswissenschaftler aus der ganzen Welt nach Frankfurt holen, damit sie sich in diesem Forschungsverbund, an dem auch das Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte beteiligt ist, austauschen und in ihren Recherchen befruchten können.
Gedanklich sind Sie im Mittelmeerraum unterwegs – was hält Sie seit vierzehn Jahren in Frankfurt?
Frankfurt steht für Vielfalt in der Stadt und an der Universität. Ich schätze den Austausch sehr, der mir an der Goethe-Universität und mit unseren Kooperationspartnern möglich ist. Wir können hier offene, die Fächergrenzen überschreitende Diskussionen führen – dies war besonders in den vergangenen vier Jahren wichtig, als wir den Antrag für den neuen Sonderforschungsbereich gemeinsam ausgearbeitet haben. Darüber hinaus besuche ich regelmäßig die Bibliotheken der Region und die Museen, die sich für Exkursionen mit meinen Studierenden eignen. Und wenn ich von den Reisen für meine Forschung und zu Tagungen zurückkehre, freue ich mich immer über den wunderschön angelegten Campus Westend. [Das Interview führte Stephanie C. Mayer-Bömoser]
[dt_call_to_action content_size=”normal” background=”plain” line=”true” style=”1″ animation=”fadeIn”]
Dieses Interview ist im Jahrbuch 2014 erschienen: [PDF-Download]
[/dt_call_to_action]